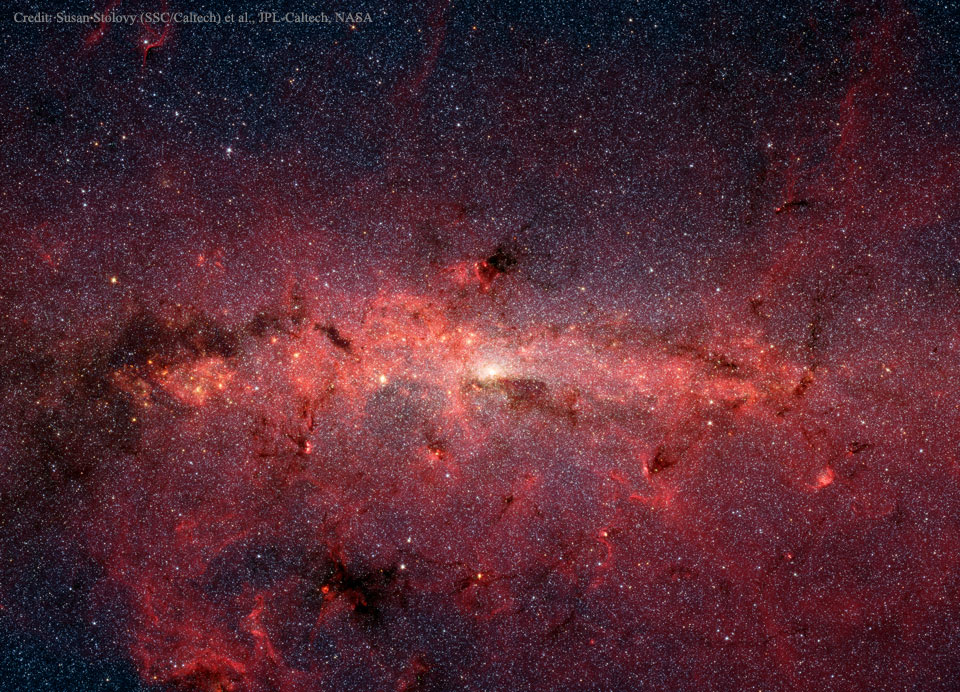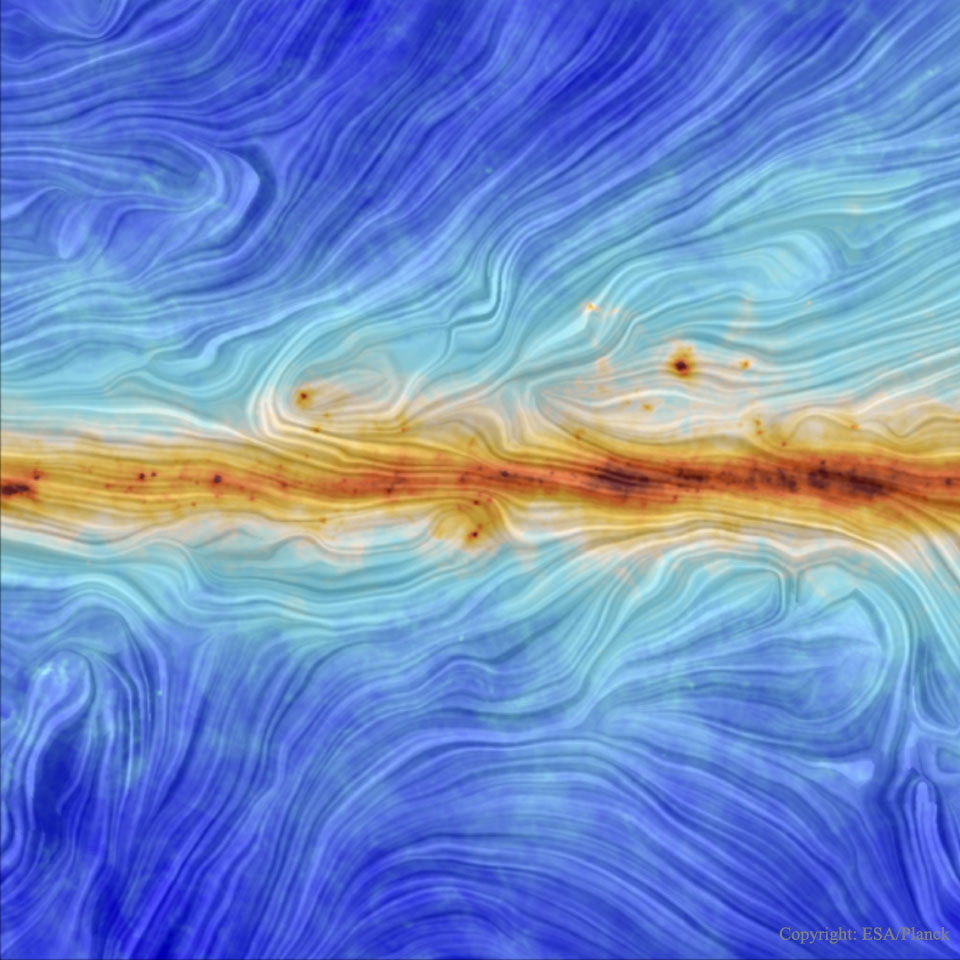Bildcredit: Hubble-Vermächtnisarchiv, NASA, ESA; Bearbeitung und Bildrechte: David Forteza)
Im Carinanebel kämpfen Sterne gegen Staub, und die Sterne gewinnen. Genauer gesagt verdampfen das energiereiche Licht und die Winde massereicher, neu entstandener Sterne die staubhaltigen Sternschmieden, in denen sie entstanden sind, und lösen sie auf.
Die Säulen im Carinanebel kennt man formlos als mystischer Berg. Sie wirken wie dunkler Staub, doch sie bestehen hauptsächlich aus durchsichtigem Wasserstoff. Staubsäulen wie diese sind viel dünner als Luft. Sie sehen nur deshalb wie Berge aus, weil sie einen relativ geringen Anteil an undurchsichtigem interstellarem Staub enthalten.
Dieses Bild ist etwa 7500 Lichtjahre entfernt. Es wurde mit dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommen und von einem Amateur digital neu bearbeitet. Es zeigt eine Region in Carina, die etwa drei Lichtjahre groß ist. In wenigen Millionen Jahren sitzen die Sterne am längeren Hebel, und der ganze Staubberg wird zerstört.
Schon gewusst? Diese Woche ist internationale Dark Sky Week!