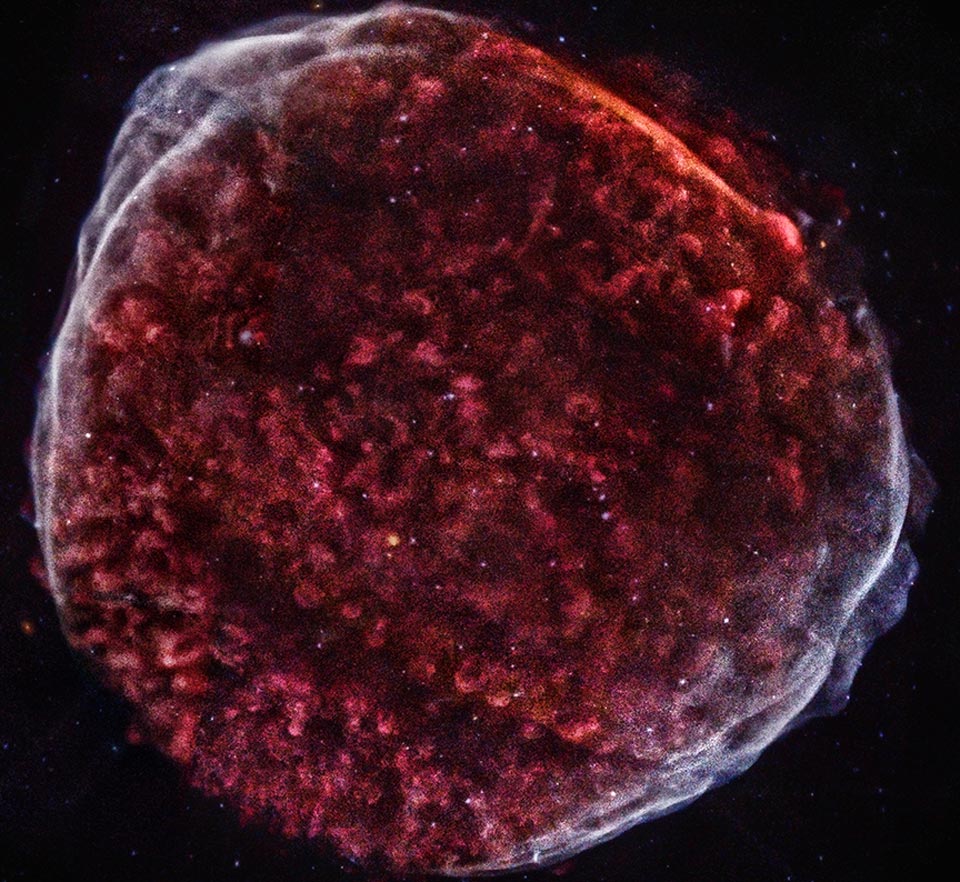Videocredit: CSA, ASC, Expedition 35
Was passiert, wenn man im Weltraum schwebend ein nasses Handtuch auswringt? Das Wasser kann im Erdorbit nicht zu Boden fallen, weil frei fallende Objekte scheinbar schweben. Fließt das Wasser aus dem Tuch? Die Antwort überrascht vielleicht.
Um es herauszufinden und um zu zeigen, wie seltsam ein Aufenthalt im Orbit sein kann, zeigte Chris Hadfield letzte Woche ein Experiment in der Mikrogravitation der Internationalen Raumstation im Erdorbit. Hadfield ist Commander der Expedition 35.
Das Video zeigt, dass einige Tropfen herausfliegen. Der Großteil des Wassers hält jedoch zusammen und bildet eine ungewöhnliche zylindrische Hülle um das Tuch. Die selbstklebende Oberflächenspannung des Wassers ist auch auf der Erde bekannt. Sie hilft zum Beispiel, künstlerische Wasserkaskaden oder gewöhnliche Regentropfen zu bilden.