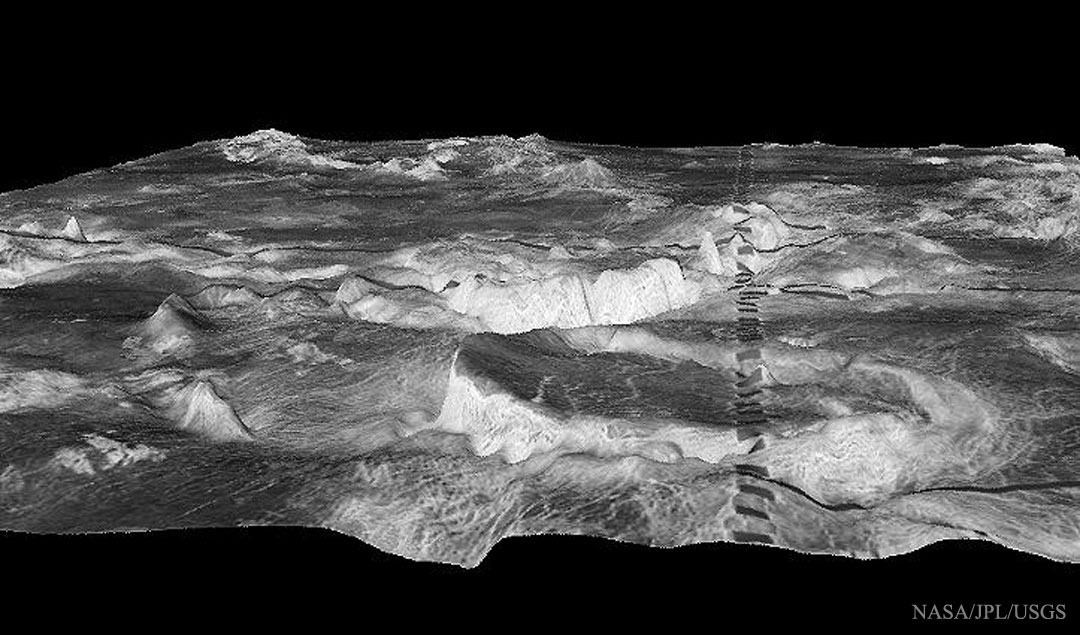Bildcredit und Bildrechte: Bjørn Jørgensen
Was schwebt da am Himmel? Ein Polarlicht, das 2012 fotografiert wurde. Fünf Tage davor fand auf unserer Sonne ein großer koronaler Massenauswurf statt. Er schleuderte eine Wolke schneller Elektronen, Protonen und Ionen zur Erde. Zwar zog ein Großteil dieser Wolke an der Erde vorbei. Doch ein Teil davon traf die Magnetosphäre unseres Planeten. Das führte in hohen nördlichen Breiten zu spektakulären Polarlichtern.
Diese Polarlichtkorona über dem Grøtfjorden in Norwegen war besonders fotogen. Das schimmernde grüne Leuchten entsteht, wenn Sauerstoff in der Atmosphäre rekombiniert. Manche erkennen in diesem Polarlicht einen großen Adler. Wenn ihr etwas anderes seht, teilt es uns mit!
Die stärkste Aktivität der Sonne ist inzwischen vorbei. Doch unsere Sonne ist weiterhin gelegentlich aktiv. Dann erzeugt sie eindrucksvolle Polarlichter auf der Erde – zum Beispiel letzte Woche.