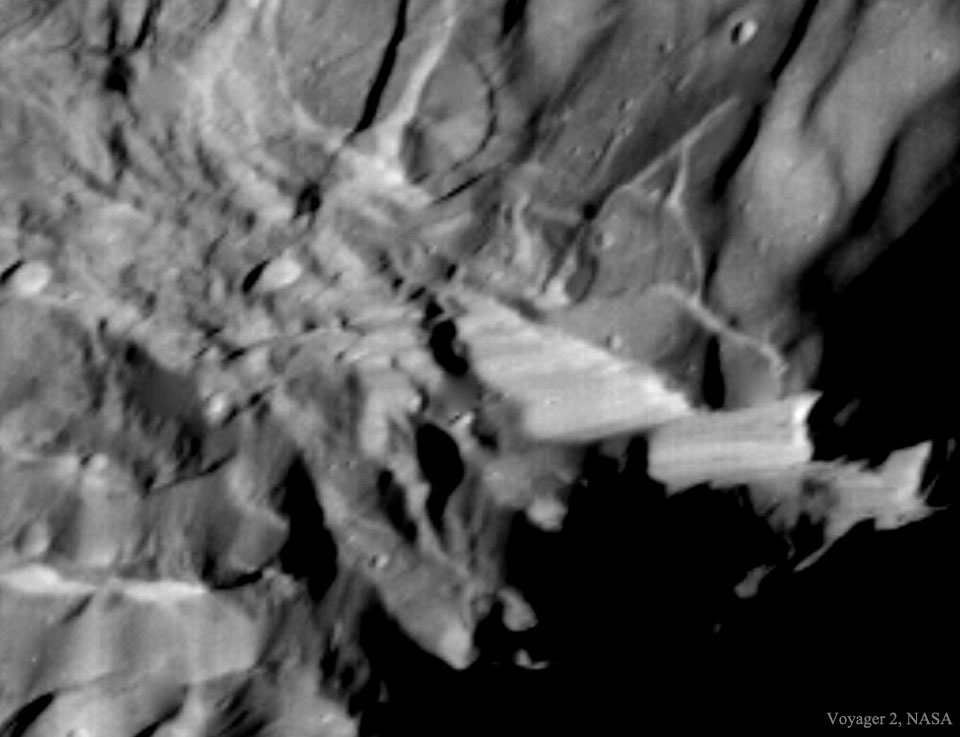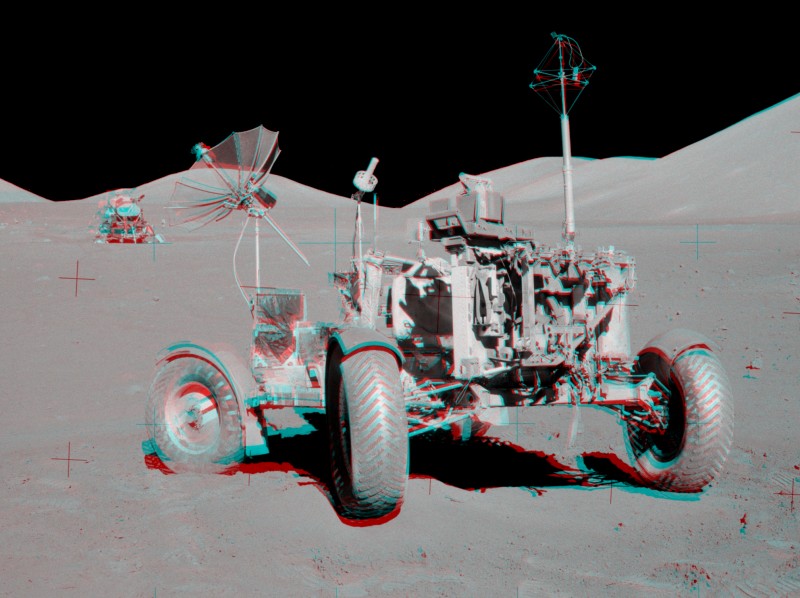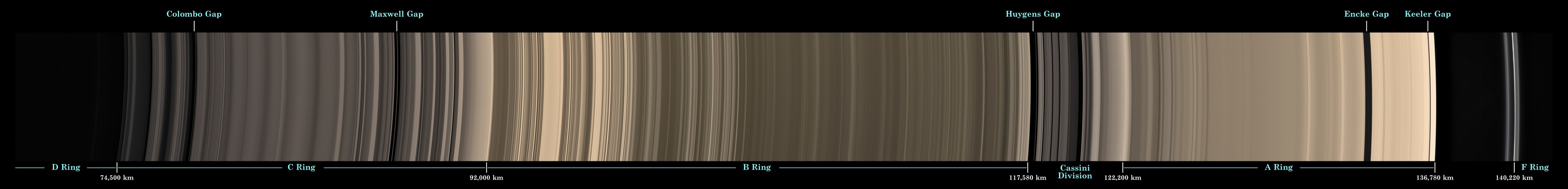Bildcredit und Bildrechte: Sergio Montúfar (Planetario Ciudad de La Plata)
Was ist mit diesem Schiff passiert? Es strandete 2002 bei einem gewaltigen Sturm an der Küste von Argentinien. Das verlassene Schiff heißt Naufragio del Chubasco. Es havarierte in der Nähe der fast verlassenen Stadt Cabo Raso (1 Einwohner).
Das rostende Schiff liefert einen malerischen, etwas gruseligen Vordergrund für den schönen Himmel oben. Der großen Bogen unserer Milchstraße wölbt sich am Himmel. Dort leuchten Galaxien, darunter die Große und die Kleine Magellansche Wolke. Auch Sterne wie Kanopus und Atair, Planeten wie Mars und Neptun sowie Nebel wie die Lagune, Carina und den Kohlensack sind zu sehen.
Das Mosaik entstand aus mehr als 80 Bildern. Sie wurden Anfang September fotografiert. Es gibt auch ein interaktives 360-Grad-Panorama dieses Bildes. Wie der waghalsige Astrofotograf berichtet, war der gruseligste Teil beim Fotografieren dieses Bildes nicht das verlassene Schiff, sondern die ungewöhnlich große Menge schwarzer, haariger Raupen.