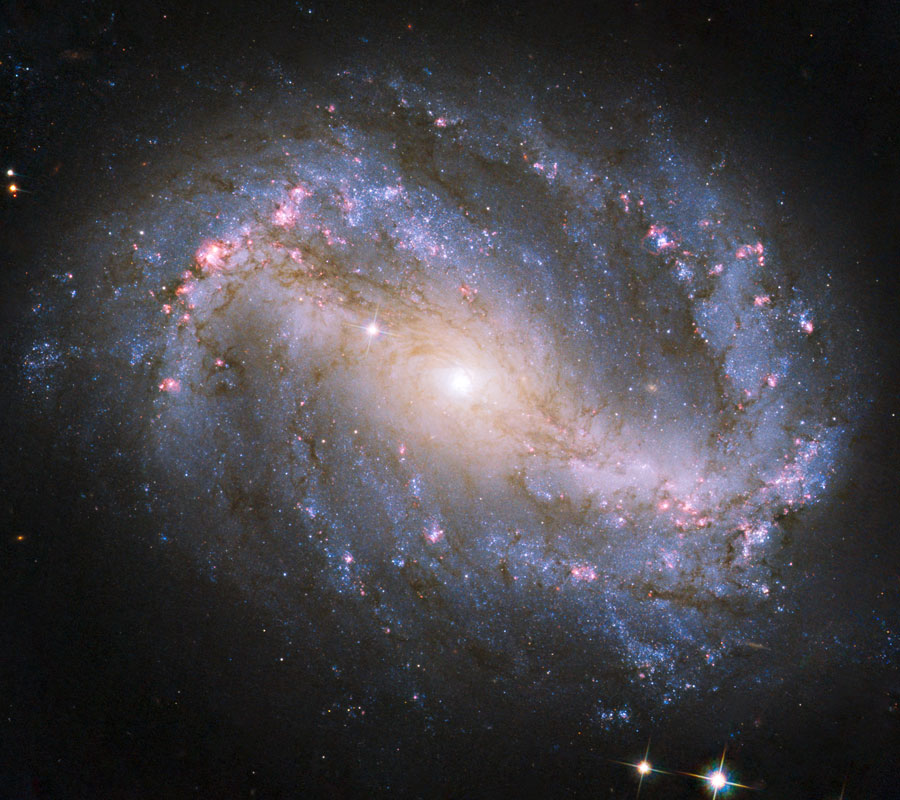NASA, JPL-Caltech, Kate Su (Steward Obs, U. Arizona) et al.
Beschreibung: Staub lässt dieses kosmische Auge rot erscheinen. Das schaurige Bild des Weltraumteleskops Spitzer zeigt Infrarotstrahlung des gut erforschten Helixnebels (NGC 7293), der sich etwa 700 Lichtjahre entfernt im Sternbild Wassermann (Aquarius) befindet. Die zwei Lichtjahre große Hülle aus Staub und Gas um einen zentralen weißen Zwerg wurde lange Zeit für ein typisches Beispiel eines planetarischen Nebels gehalten, der das Endstadium in der Entwicklung eines sonnenähnlichen Sterns repräsentiert. Doch die Spitzer-Daten zeigen, dass der Zentralstern des Nebels selbst in überraschend helles Infrarotleuchten getaucht ist. Modelle lassen darauf schließen, dass das Leuchten durch durch eine Trümmerwolke aus Staub erzeugt wird. Obwohl das Material des Nebels vor vielen tausend Jahren von dem Stern abgestoßen wurde, könnte der nahe am Stern liegende Staub durch Kollisionen in einer Ansammlung von Objekten ähnlich dem Kuipergürtel oder der Oortschen Kometenwolke in unserem Sonnensystem entstehen. Die kometenähnlichen Körper, die in dem fernen planetaren Systemen gebildet wurden, hätten andernfalls sogar die dramatischen späten Stadien der Entwicklung des Sterns überlebt.