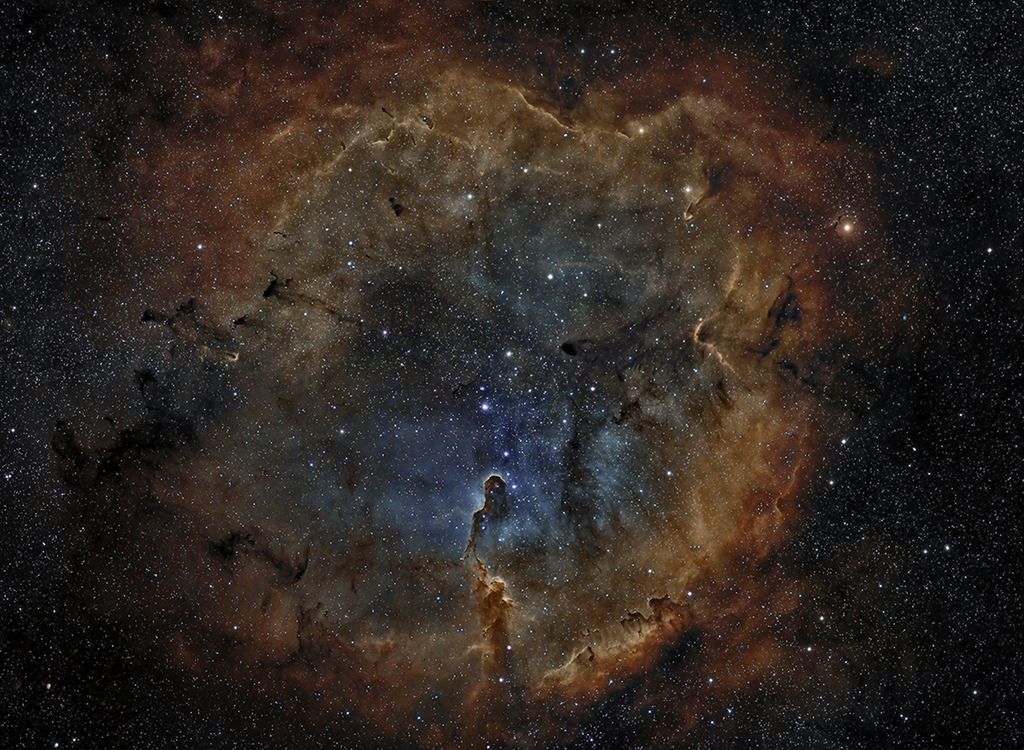Bildcredit und Bildrechte: Bearbeitung – Robert Gendler, Roberto Colombari; Daten – Hubble-Vermächtnisarchive, Europäische Südsternwarte ESO
Die verzerrte Galaxie NGC 2442 liegt im südlichen Sternbild Fliegender Fisch (Piscis Volans). Sie ist etwa 50 Millionen Lichtjahre entfernt. Die beiden Spiralarme der Galaxie beginnen beim ausgeprägten Zentralbalken. Sie wirken auf Weitwinkelbildern hakenförmig.
Diese Nahaufnahme ist ein Mosaik. Es entstand aus Daten des Weltraumteleskops Hubble und der Europäischen Südsternwarte ESO. Das Bild zeigt die Struktur der Galaxie äußerst detailreich. Der Kern leuchtet im gelblichen Licht einer älteren Sternpopulation. Er ist von undurchsichtigen Staubbahnen, jungen blauen Sternhaufen und rötlichen Sternbildungsregionen umgeben.
Die scharfen Bilddaten zeigen auch fernere Galaxien im Hintergrund. Man sieht sie direkt durch die Nebel und Sternhaufen in NGC 2442. In der geschätzten Entfernung von NGC 2442 ist das Bild etwa 75.000 Lichtjahre breit.