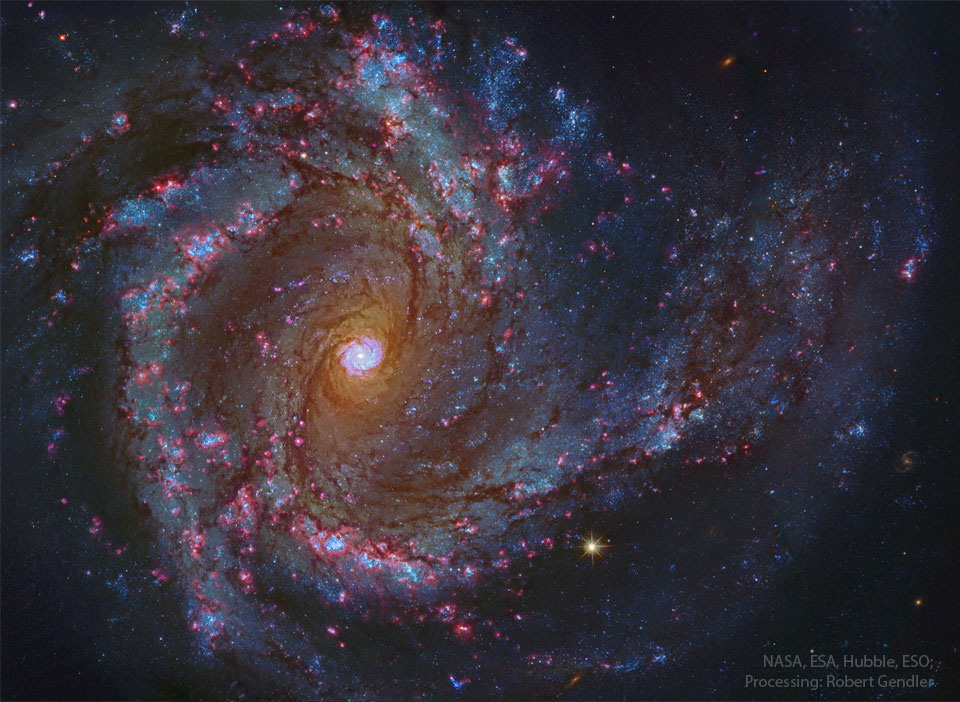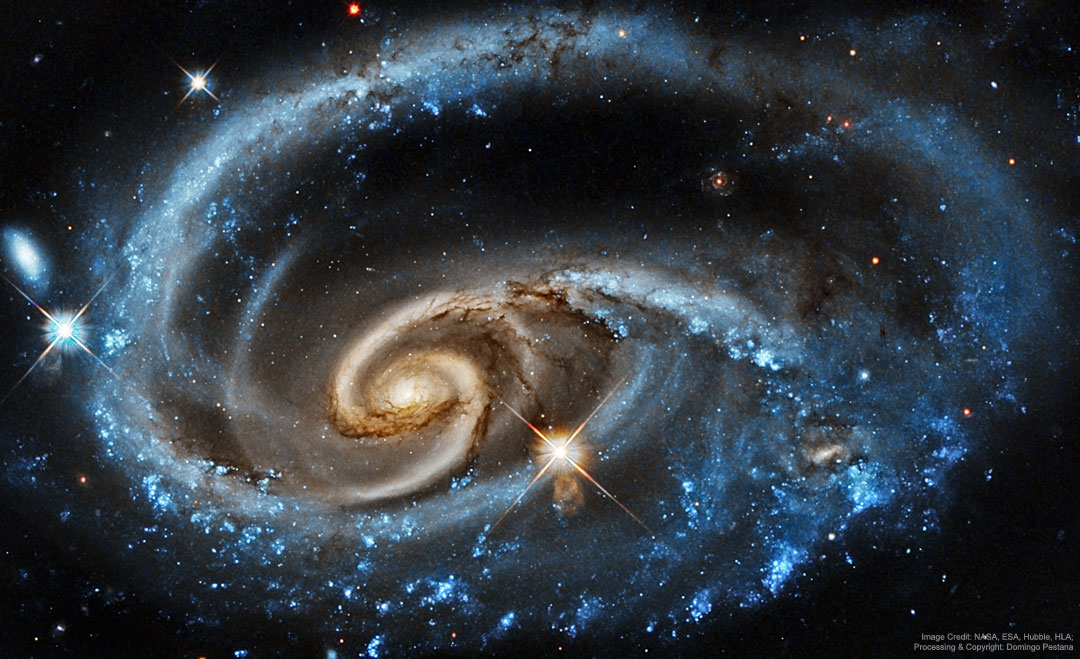Bildcredit und Bildrechte: Timothy Martin
Das ist eine Wolke aus leuchtendem Gas und verdunkelndem Staub zwischen den Sternen. Für Astronom*innen auf der Erde sieht sie aus wie ein Vogel. Sie trägt deshalb den Namen „Möwen-Nebel“.
Dieses Breitbandbild des kosmischen Vogels zeigt einen 3,5 Grad breiten Streifen der Milchstraße. Dieser befindet sich ungefähr in Richtung des Sirius, dem hellsten Stern im Sternbild Großer Hund. Der helle Kopf des Möwennebels ist trägt die Katalogbezeichnung IC 2177. Er ist ein kompakter, staubiger Emissions- und Reflexionsnebel mit dem eingebetteten massereichen Stern HD 53367.
Die gesamte Emissionsregion besteht aus Objekten mit anderen Katalogbezeichnungen. Er ist wahrscheinlich Teil einer ausgedehnten Hüllenstruktur und durch aufeinanderfolgende Supernova-Explosionen entstanden.
Der auffällige bläuliche Bogen rechts unterhalb der Mitte ist die Bugstoßwelle des Ausreißer-Sterns FN Canis Majoris.
Dieser Komplex aus Sternen der Canis Majoris OB1-Gruppe und interstellaren Gas- und Staubwolken leuchtet rötlich im Licht des angeregten Wasserstoffs. Er erstreckt sich über eine Größe von 200 Lichtjahren und befindet ist rund 3800 Lichtjahre von uns entfernt.