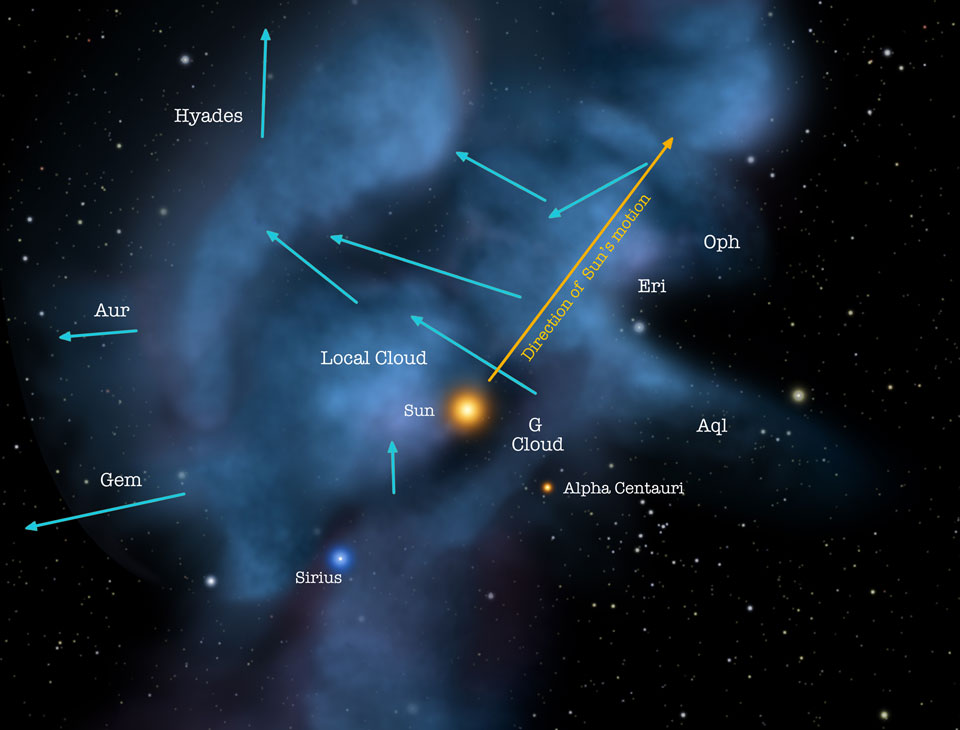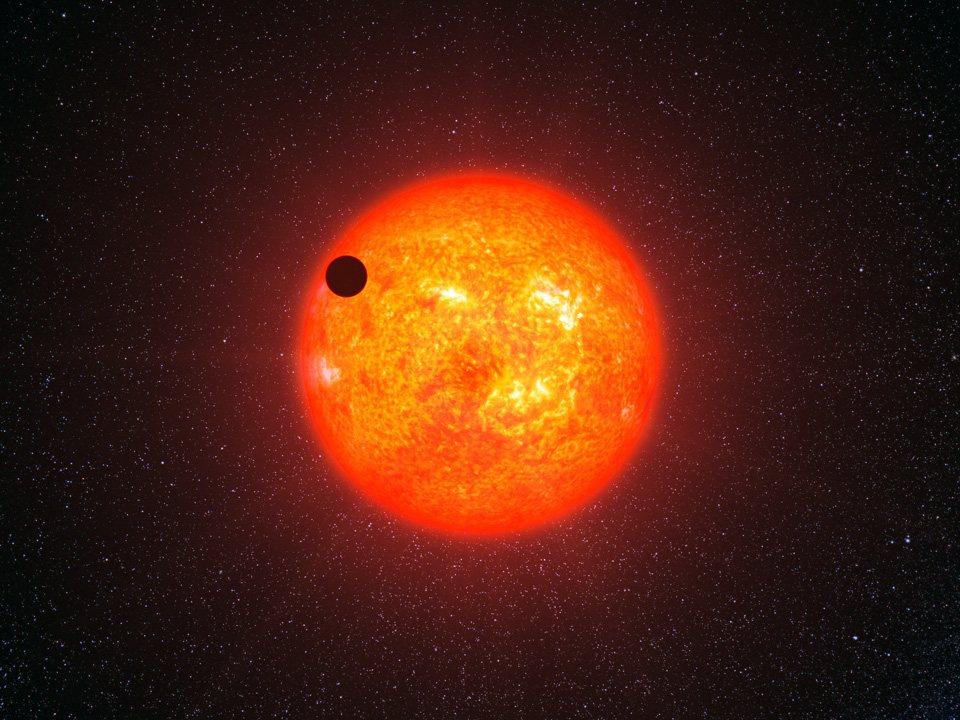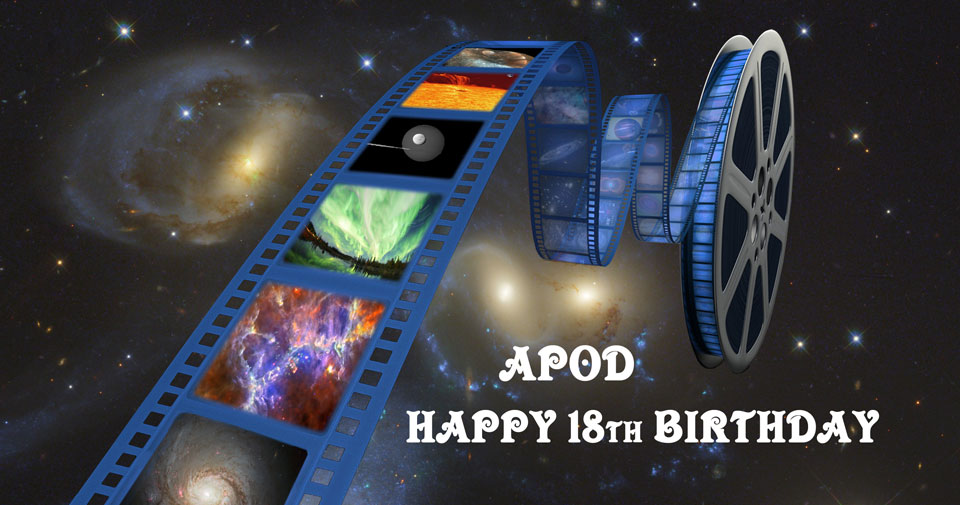Bildcredit und Bildrechte: Jerónimo Losada
Wenn ihr auf diesen prächtigen Baum klettert, könnt ihr scheinbar nach oben greifen und den Himmelsnordpol in der Mitte der Strichspurbögen berühren. Das gut arrangierte Bild entstand in der Nacht des 5. Oktober. Während fast 2 Stunden entstand eine Serie je 30 Sekunden belichteter Aufnahmen. Die Einzelbilder wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen, die bei Almadén de la Plata in der südspanischen Provinz Sevilla auf der Erde auf einem Stativ fixiert war.
Die zierlichen Strichspuren zeigen die tägliche Rotation der Erde um ihre Achse. Die Verlängerung der Rotationsachse führt am Nachthimmel zur Mitte der konzentrischen Bögen. Auf der Nordhalbkugel steht passenderweise der helle Stern Polaris nahe beim Himmelsnordpol. Er bildet die kurze helle Spur in der Mitte zwischen den belaubten Zweigen.