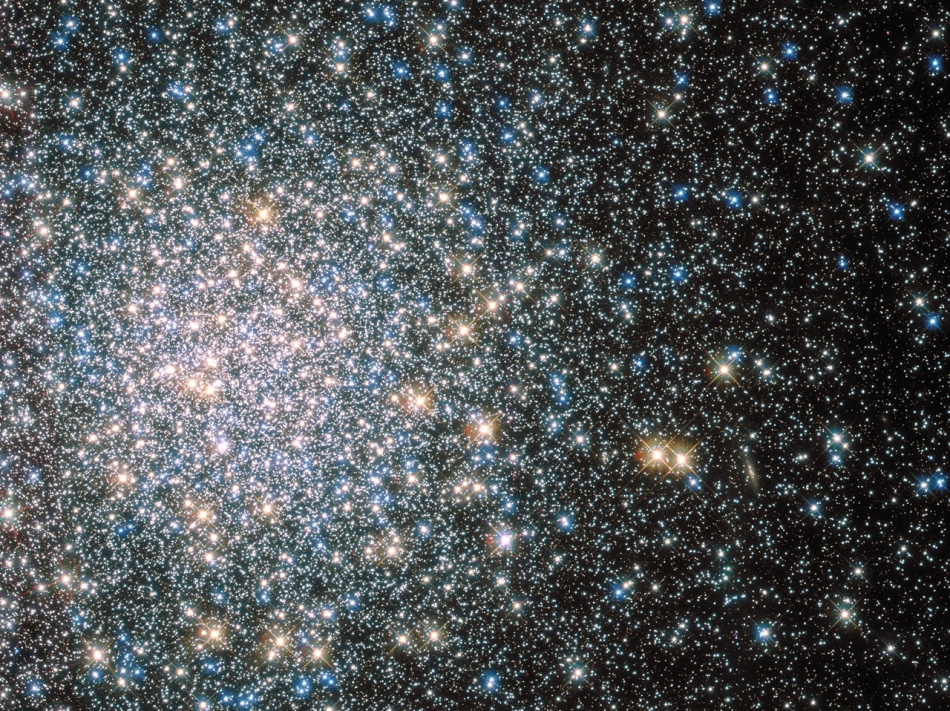Bildcredit und Bildrechte: Stephen Mudge
Am Himmel über der australischen Stadt Brisbane gingen am 29. April Sonne und Neumond gemeinsam unter. Dort bildete die himmlische Aufreihung bei der ersten Sonnenfinsternis 2014 eine partielle Sonnenfinsternis. Brisbane liegt in der südöstlichen Ecke von Queensland auf dem Planeten Erde.
Das dramatische Komposit entstand aus digital gestapelten Bildern. Sie in wurden alle etwa 5 Minuten mit Teleobjektiv fotografiert. Das Bild zeigt, wie sich die Finsternis dem Westhorizont nähert. Neben der Mondsilhouette sind Strahlenbüschel von Wolkenbänken zu sehen.
In Brisbane war das Maximum der Finsternis knapp nach Sonnenuntergang erreicht. Dabei bedeckte der Mond etwa 25 Prozent der Sonne. Nur an einem einsamen Ort in der Antarktis konnte man die kurze ringförmige Finsternisphase sehen. Dabei war die ganze dunkle Mondscheibe von einem dünnen, hellen Feuerring umgeben.