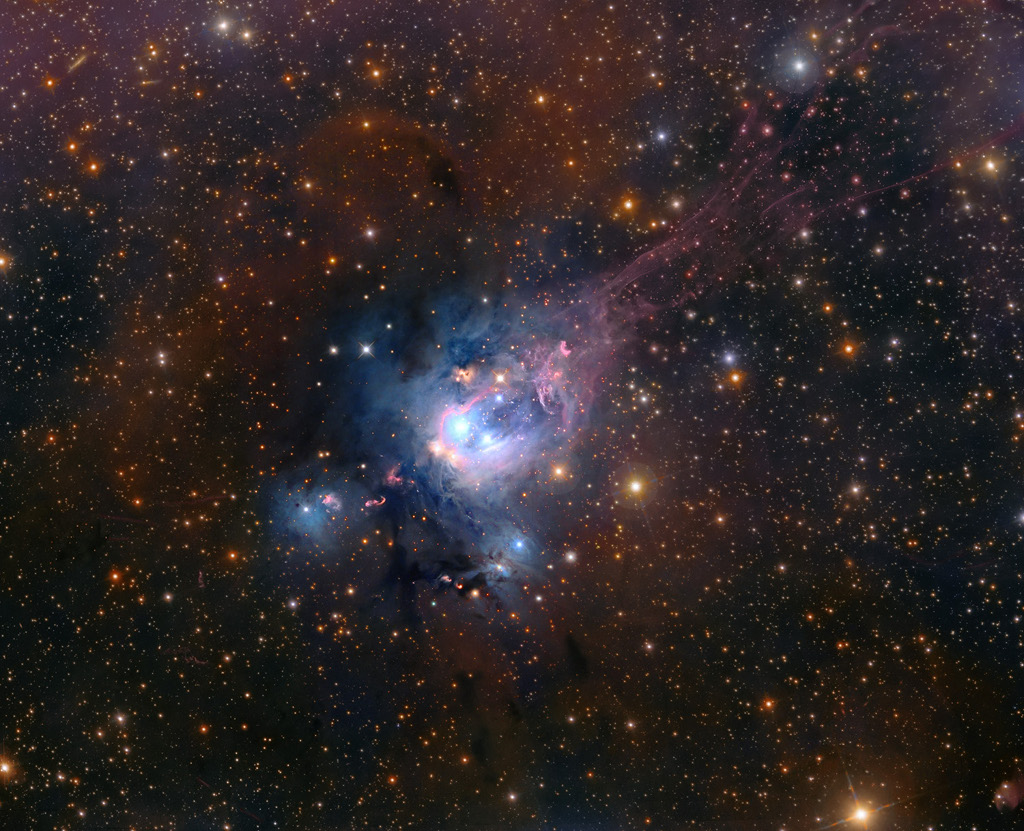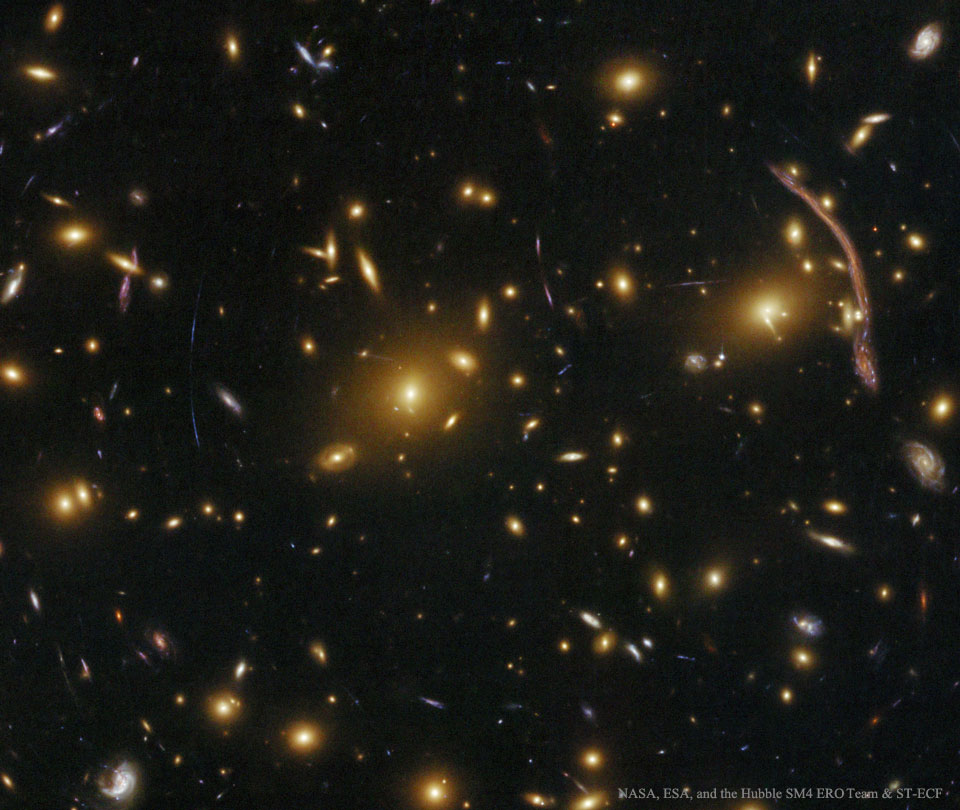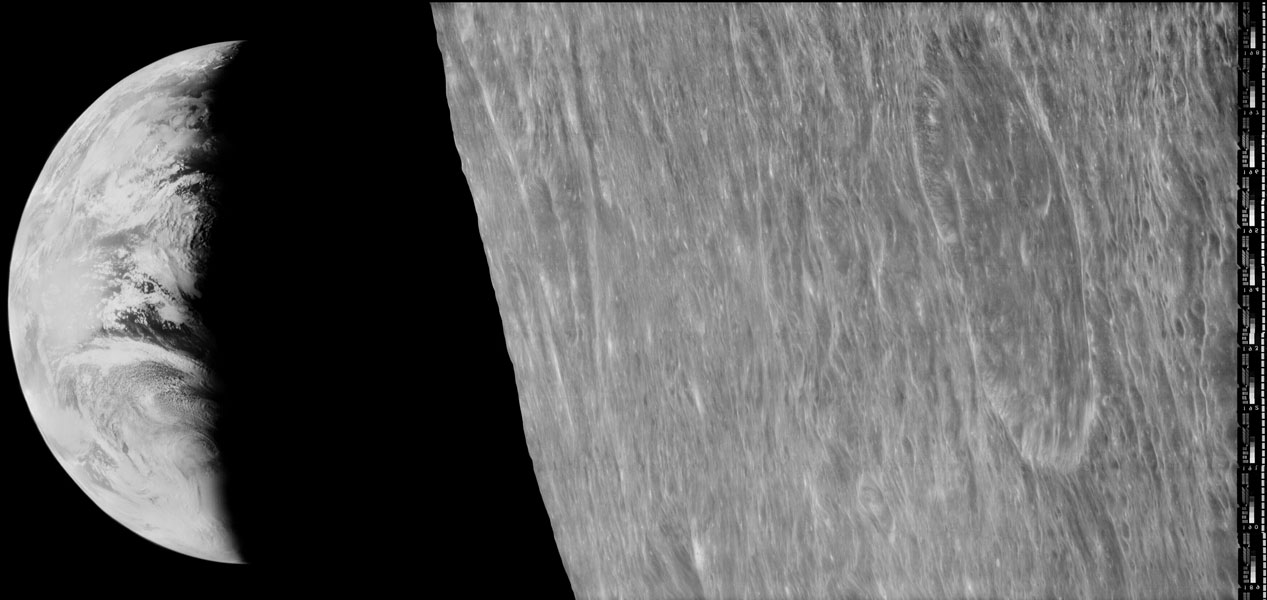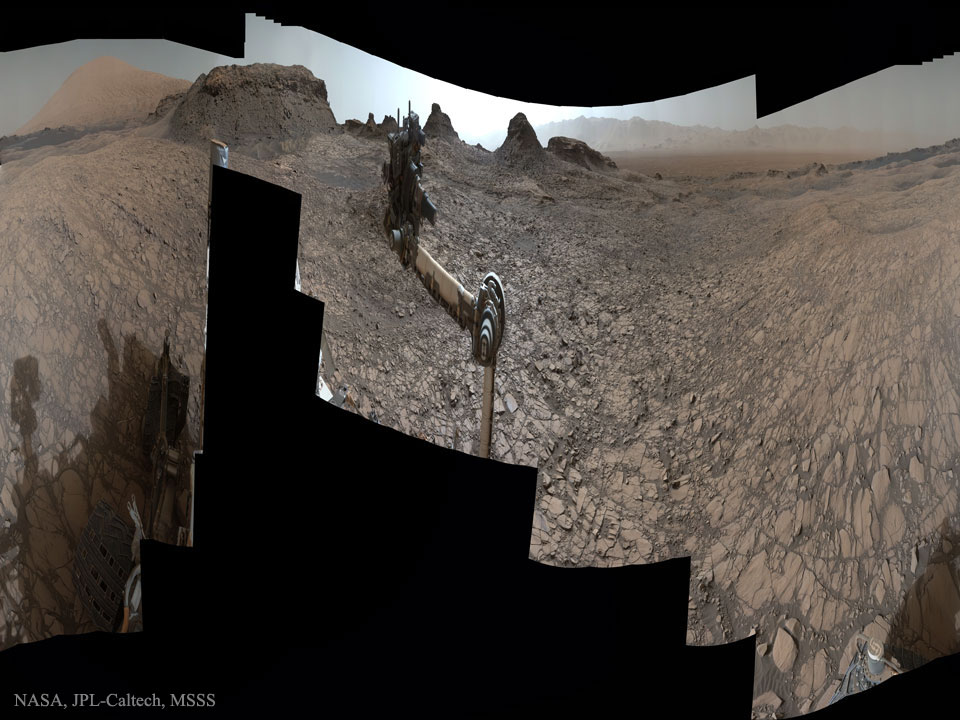Bildcredit und Bildrechte: Juan Carlos Casado (TWAN, StarryEarth)
Bewundert die Schönheit, aber fürchtet das Biest. Die Schönheit ist das Polarlicht oben. Es bildet eine große, grüne Spirale. Sie windet sich zwischen malerischen Wolken. Daneben leuchten der helle Mond und im Hintergrund die Sterne. Die Bestie ist eine Welle geladener Teilchen. Sie erzeugten das Polarlicht. Eines Tages schadet so eine Welle vielleicht der Zivilisation.
1859 gab es in dieser Woche auf der ganzen Welt eindrucksvolle Polarlichter. Sie traten nach einem Impuls geladener Teilchen auf, die von einem koronalen Massenauswurf (KMA) stammten. Der KMA trat bei einer Sonneneruption auf. Er traf die Magnetosphäre der Erde so heftig, dass er das Carrington-Ereignis auslöste. Zuvor räumte vielleicht ein KMA einen relativ direkten Pfad zwischen Sonne und Erde frei.
Das Carrington-Ereignis komprimierte das Erdmagnetfeld so gewaltig, dass dadurch Ströme in Telegrafendrähten induziert wurden. Diese Ströme waren so stark, dass Drähte Funken sprühten. Telegrafistinnen bekamen davon Stromschläge. Wenn heute ein Ereignis der Carrington-Klasse die Erde trifft, gibt es wahrscheinlich Schäden in globalen Stromnetzen und elektronischen Geräten, die ein nie da gewesenes Ausmaß erreichen.
Dieses Polarlicht wurde letzte Woche über dem Þingvallavatn auf Island fotografiert. Dieser See füllt teilweise eine Verwerfung zwischen zwei großen tektonischen Platten der Erde: der eurasischen und die nordamerikanischen Platte.