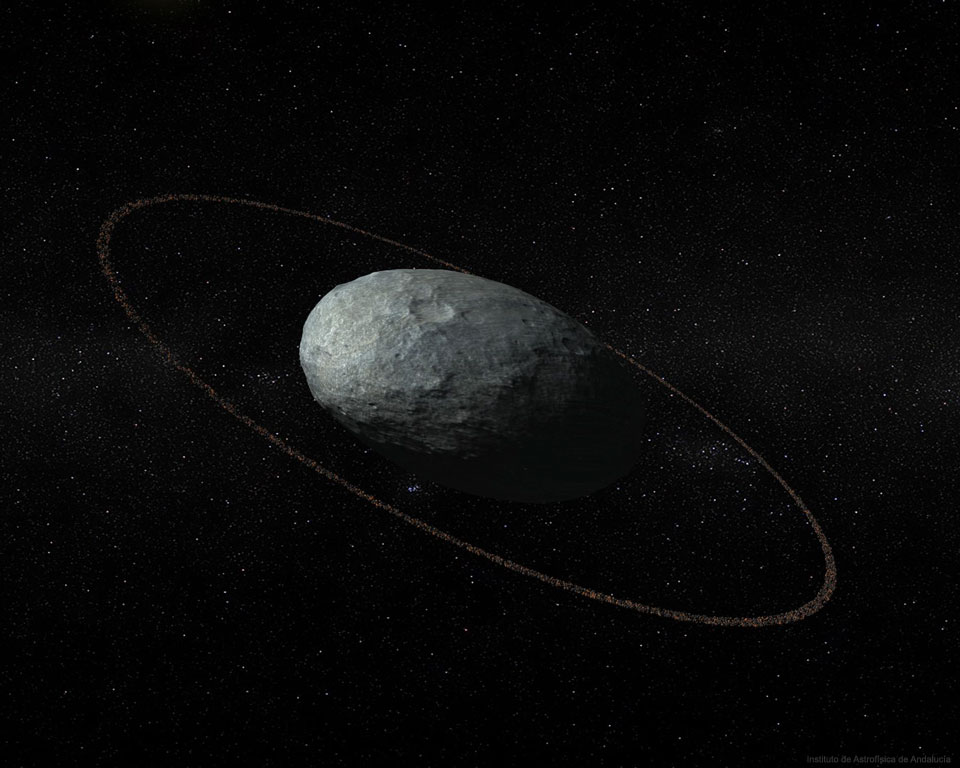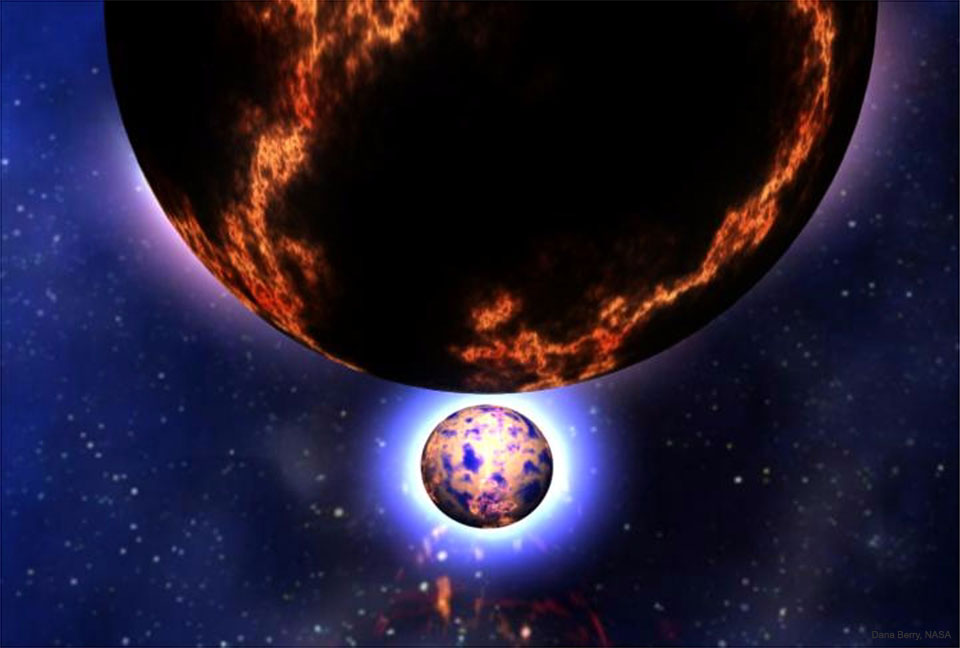Bildcredit und Bildrechte: Kerry-Ann Lecky Hepburn (Weather and Sky Photography)
Suche den großen Wagen. Dann folge vom Kasten aus der Deichsel bis zum letzten hellen Stern. Schiebe das Teleskop ein Stück nach Südwesten. Dort findest du dieses faszinierende Paar wechselwirkender Galaxien. Es ist der 51. Eintrag in Charles Messiers berühmtem Katalog.
Die große Galaxie hat eine gut definierte Spiralstruktur. Sie ist vielleicht der ursprüngliche Spiralnebel und auch als NGC 5194 katalogisiert. Ihre Spiralarme und Staubbahnen ziehen klar über ihre Begleitgalaxie NGC 5195 (unten). Das Paar ist etwa 31 Millionen Lichtjahre entfernt und liegt offiziell im kleinen Sternbild Jagdhunde.
M51 wirkt blass und verschwommen, wenn man sie mit dem Auge betrachtet. Doch auf so detailreichen Bildern sieht man plakative Farben und blasse Ablagerungen um die kleine Galaxie, die durch Gezeiten entstanden sind.