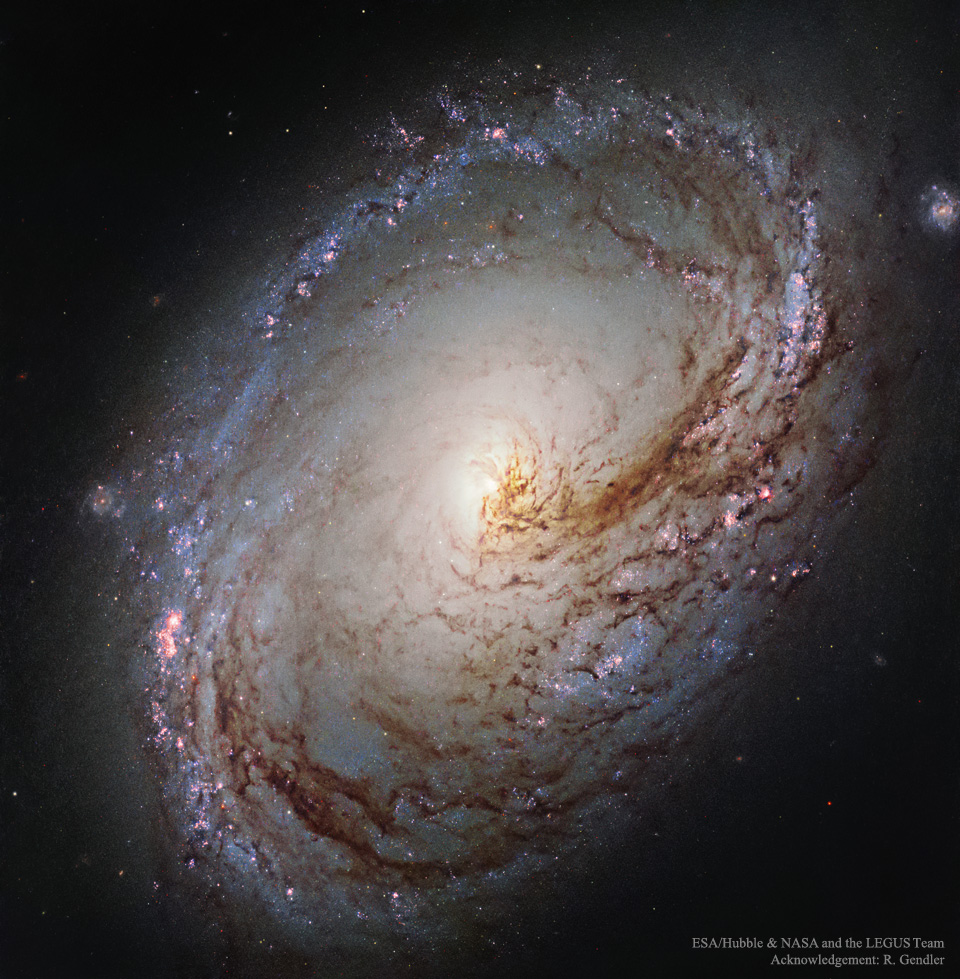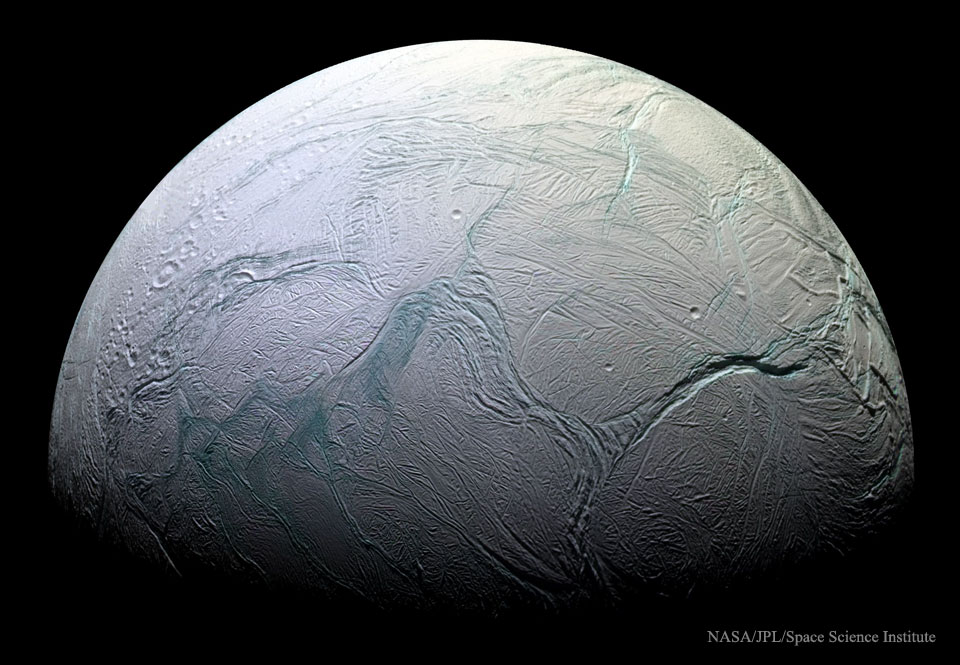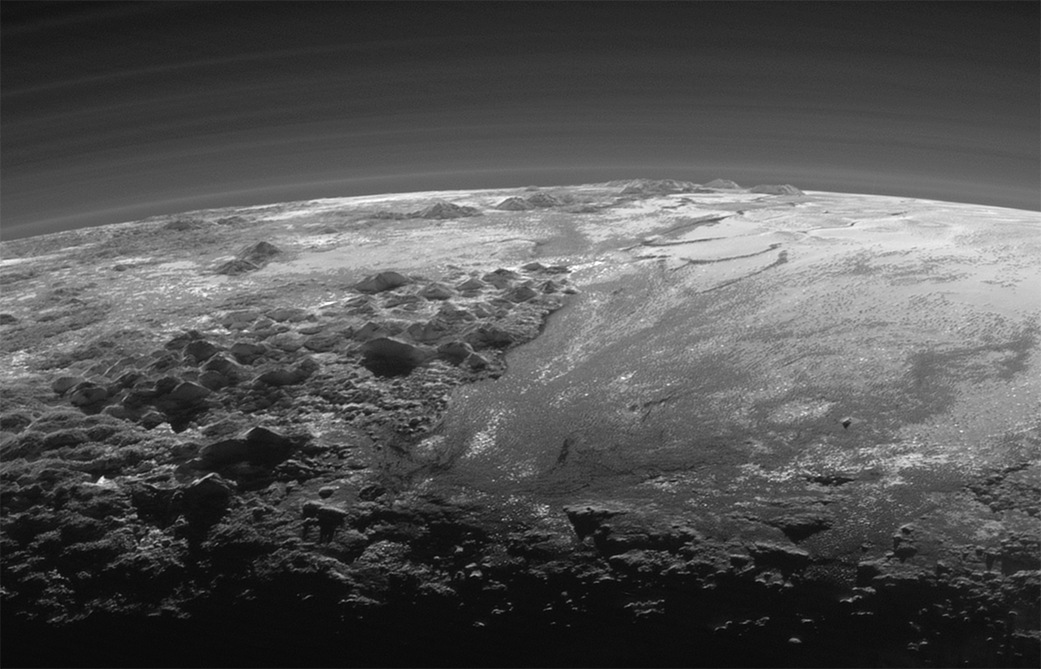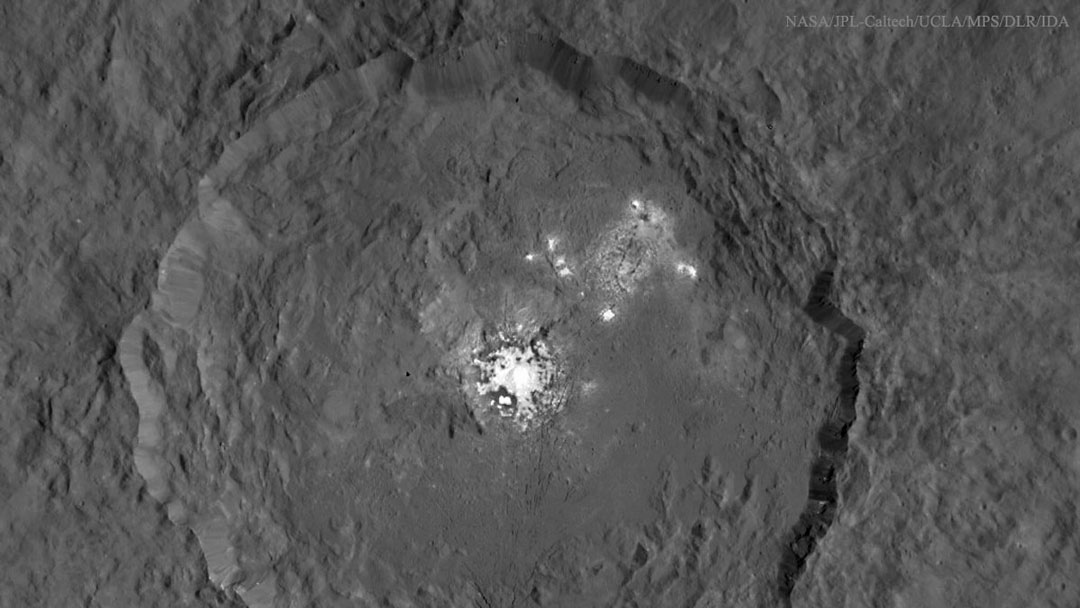Bildcredit und Bildrechte: Sebastián D‘ Alessandro; Rollover-Beschriftung: Judy Schmidt
Was sind die Lichtstreifen am Himmel? Die große gewölbte Struktur ist das zentrale Band der Milchstraße. Darin sind Millionen ferner Sterne erkennbar, gemischt mit vielen dunklen Staubbahnen.
Weniger gut erkennt man einen fast senkrechten Lichtkegel. Er steigt rechts neben der Bildmitte vom Horizont auf. Es ist Zodiakallicht, das ist Sonnenlicht, das vom Staub im Sonnensystem gestreut wird. Sein Schimmer ist kurz nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang zu sehen, manchmal sogar überraschend deutlich.
Im Vordergrund stehen mehrere Teleskope. Sie gehören zum Bosque-Alegre-Observatorium. Es wird von der Nationalen Universität Córdoba in Argentinien betrieben. Die Station bietet am Wochenende Besichtigungen an. Sie erforscht astronomische Objekte wie Kometen, aktive Galaxien und Galaxienhaufen. Das Bild entstand Anfang des Monats.