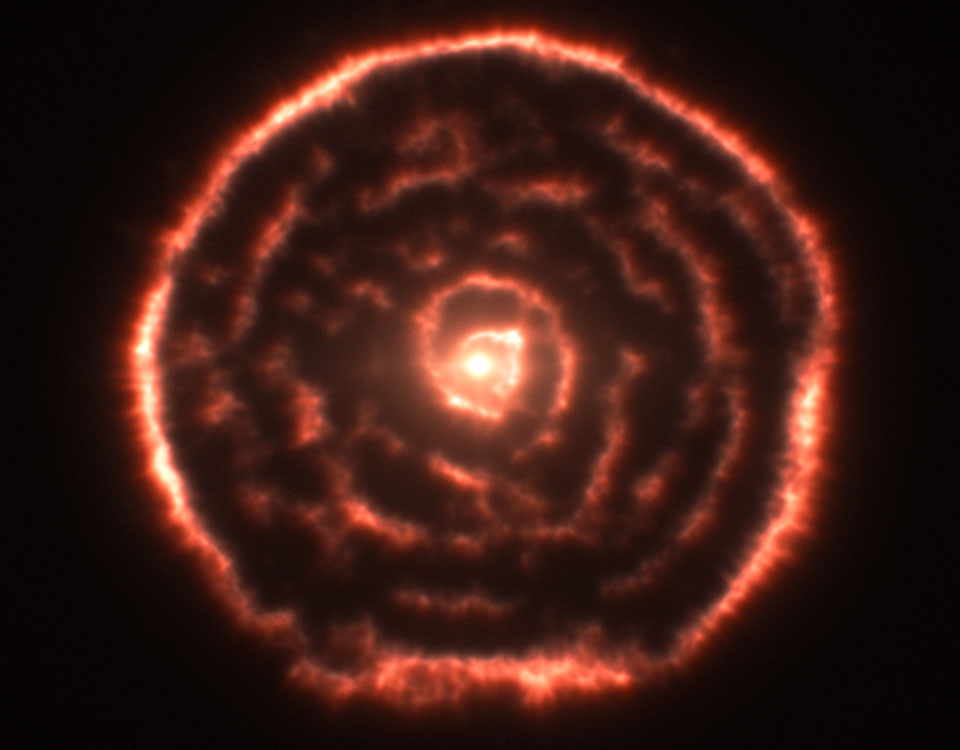Bildcredit und Bildrechte: Bob Franke
Drei Objekte springen auf diesem gut geplanten Teleskopbild ins Auge. Es ist eine Ansicht im eher stillen Sternbild Luchs. Zwei helle Objekte mit Spitzen sind nahe Sterne. Das dritte Objekt ist der ferne Kugelsternhaufen NGC 2419. Er ist fast 300.000 Lichtjahre entfernt. NGC 2419 wird manchmal als intergalaktischer Wanderer bezeichnet. Der Titel passt gut, denn im Vergleich dazu ist die Große Magellansche Wolke (GMW) nur etwa 160.000 Lichtjahre beträgt. Die GMW ist eine Begleitgalaxie der Milchstraße.
NGC 2419 ähnelt anderen großen Kugelsternhaufen wie Omega Centauri. Er leuchtet hell, ist aber eine blasse Erscheinung, weil er so weit entfernt ist. NGC 2419 hat vielleicht tatsächlich einen extragalaktischen Ursprung. Er könnte der Rest einer kleinen Galaxie sein, die von der Milchstraße eingefangen und zerrissen wurde. Seine extreme Entfernung erschwert die Forschung. Man kann seine Eigenschaften nicht so leicht mit anderen Kugelsternhaufen im Halo unserer Milchstraße vergleichen.