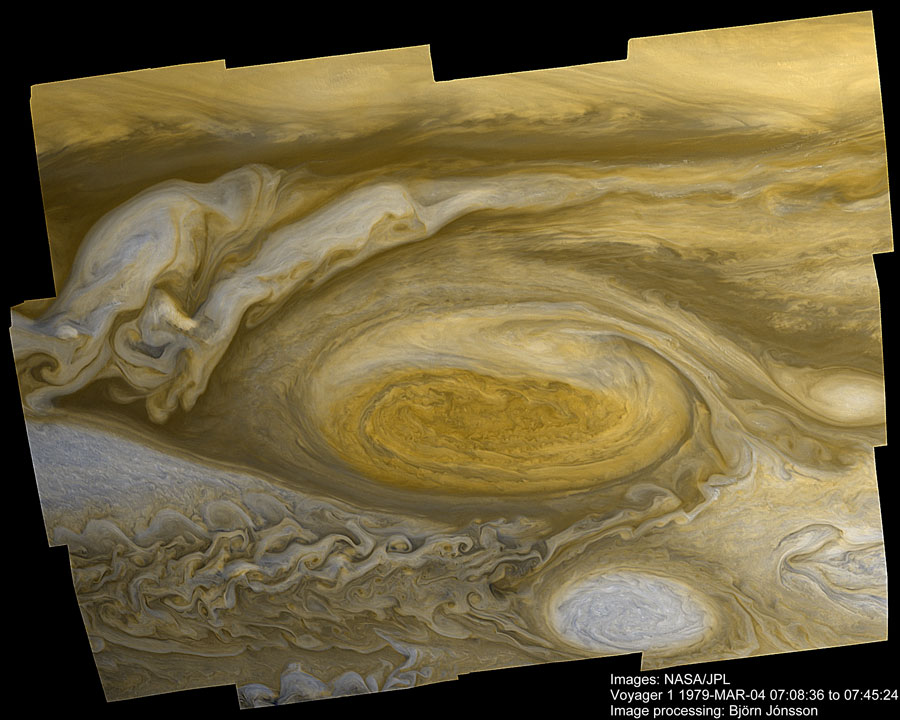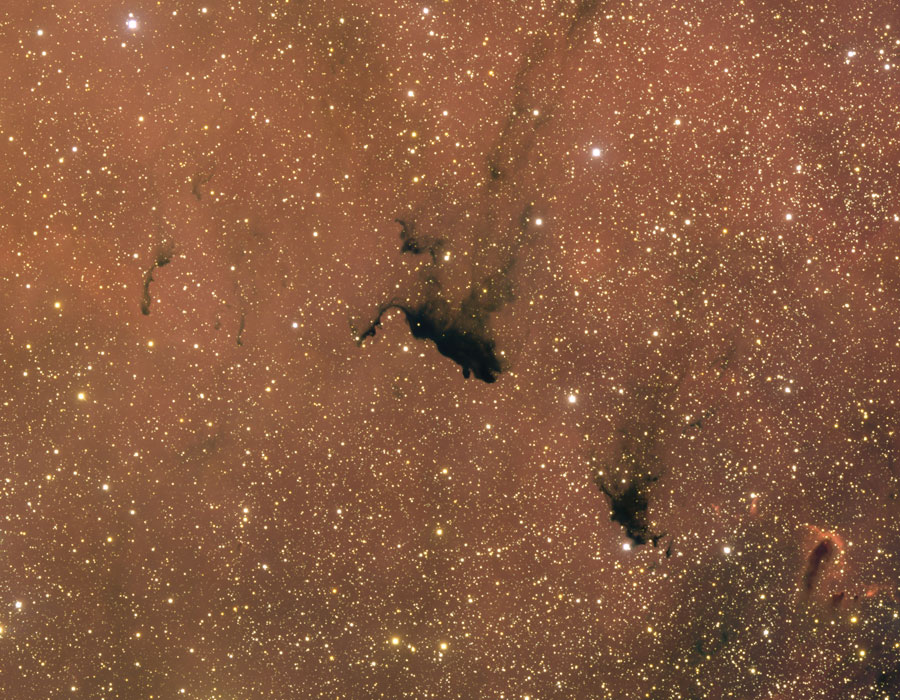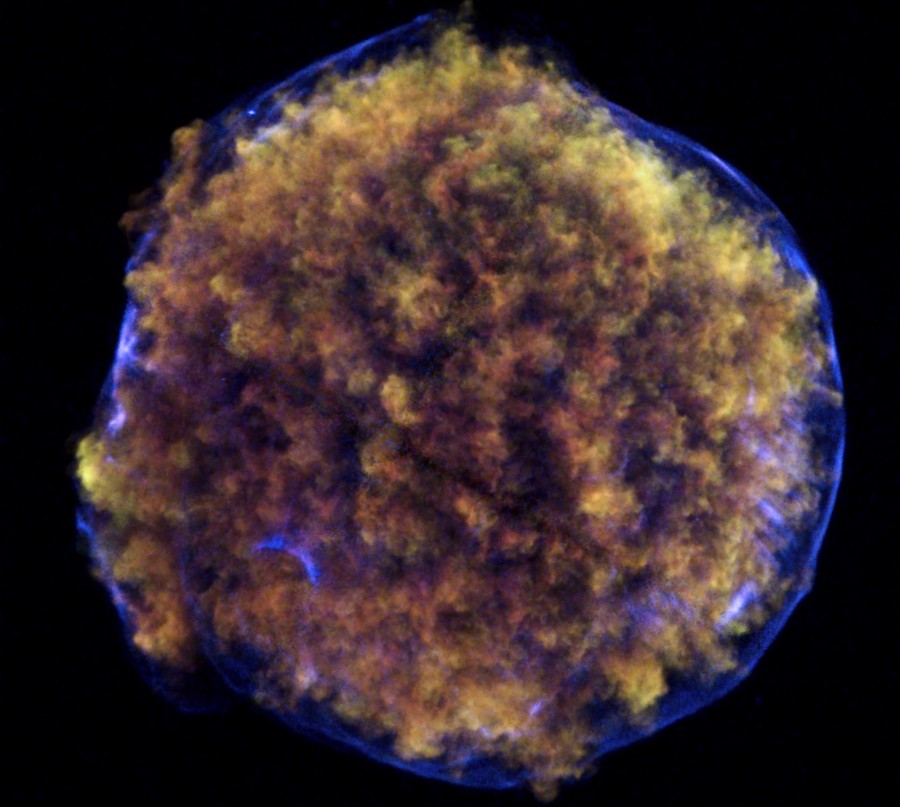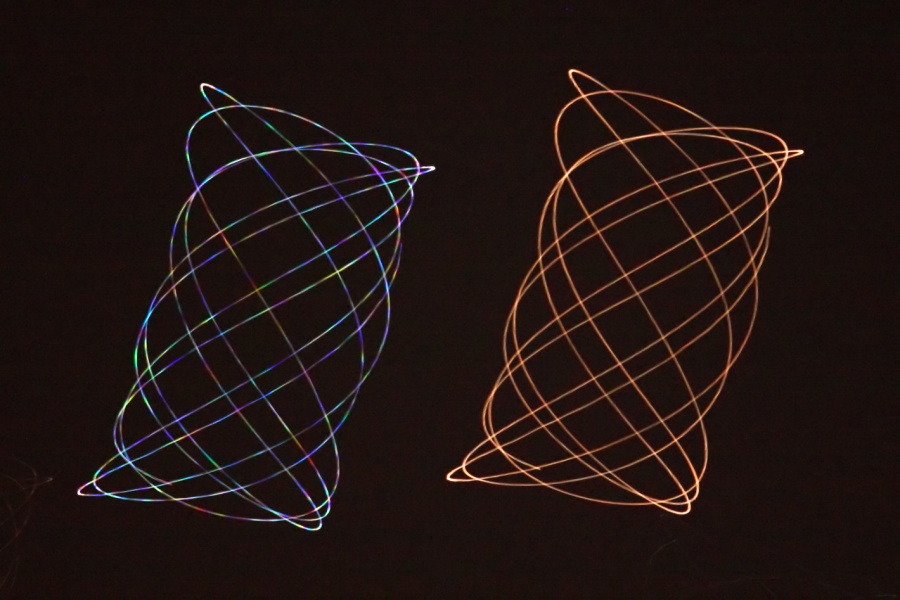Beschreibung: Sterne schwärmen wie Bienen um das Zentrum des hellen Kugelsternhaufens M15. Diese Kugel aus mehr als 100.000 Sternen ist ein Relikt aus den frühen Jahren unserer Galaxis und umkreist immer noch das Zentrum der Milchstraße.
M15, einer von etwa 150 noch übrigen Kugelsternhaufen. Man sieht ihn leicht mit einem Fernglas. Er besitzt eine der dichtesten Sternkonzentrationen im Zentrum, die wir kennen, und weist einen großen Reichtum an veränderlichen Sternen und Pulsaren auf.
Dieses scharfe Bild wurde vom Weltraumteleskop Hubble aufgenommen. Es ist etwa 120 Lichtjahre breit und zeigt die dramatische Zunahme der Sterndichte im Zentrum des Haufens. M15 ist etwa 35.000 Lichtjahre entfernt und liegt im Sternbild des geflügelten Pferdes Pegasus. Neue Hinweise lassen ein massereiches schwarzes Loch im Zentrum von M15 vermuten.