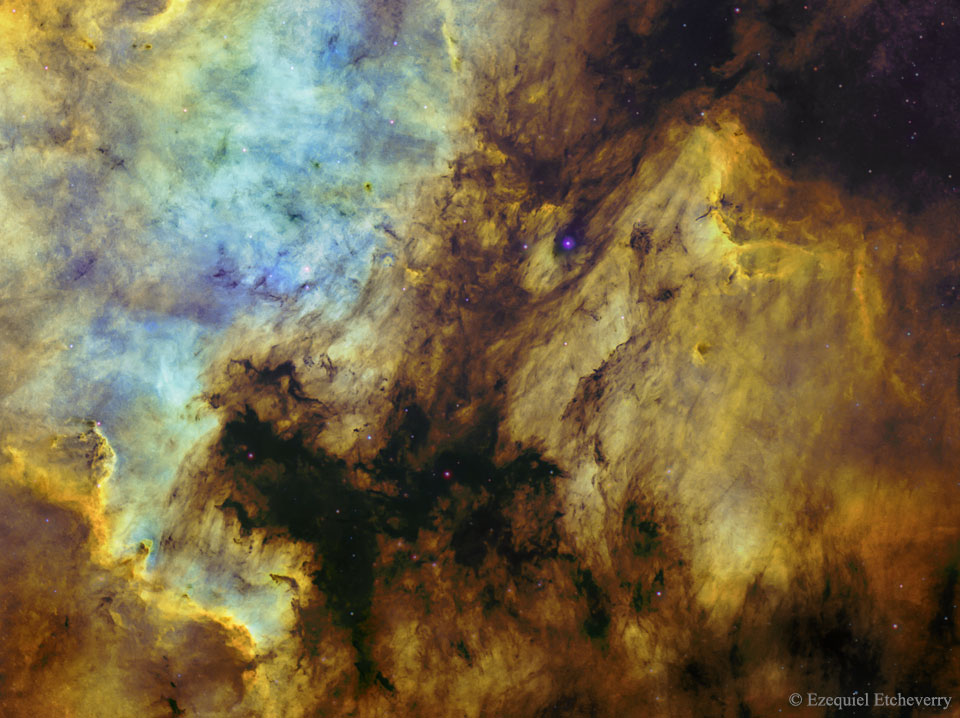Illustrationscredit: LIGO, NSF
Ein neuer Himmel wird sichtbar. Wenn ihr hinauf blickt, seht ihr Licht am Himmel. Licht ist elektromagnetische Strahlung. Doch seit letztem Jahr können wir Menschen den einst vertrauten Himmel in einer anderen Art von Strahlung sehen. Es ist die Strahlung von Gravitationswellen.
Heute veröffentlichte die LIGO-Arbeitsgruppe die Entdeckung von GW151226. Es ist nach GW150914 der zweite bestätigte Blitz von Gravitationswellen. GW150914 war die historische erste Entdeckung. Sie wurde vor drei Monaten gemeldet. Der Name GW151226 deutet an, dass man das Ereignis Ende Dezember 2015 entdeckte. Der Blitz wurde von beiden LIGO-Anlagen gleichzeitig registriert. Die Detektoren stehen in den US-Bundesstaaten Washington und Louisiana.
Diese Animation zeigt, wie sich die Frequenz von GW151226 während der Messung am Observatorium in Hanford in Washington änderte. Das System, von dem die Gravitationswellen stammen, passt am besten zu zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern. Sie haben anfangs etwa 14 und 8 Sonnenmassen. Die Rotverschiebung beträgt ungefähr 0,09. Wenn das stimmt, brauchte diese Strahlung grob geschätzt 1,4 Milliarden Jahre bis zu uns.
Die Stärke und die Frequenz der Gravitationswellen wurden als Ton dargestellt. In der letzten Sekunde, bevor die Schwarzen Löcher verschmelzen, erreicht der Klang den höchsten Ton. LIGO arbeitet weiter, seine Empfindlichkeit steigt und in den nächsten Jahren gehen weitere Messgeräte für Gravitationswellen in Betrieb. Das bietet eine neue Sicht auf den Himmel. Es wird das menschliche Verständnis vom Universum verändern.