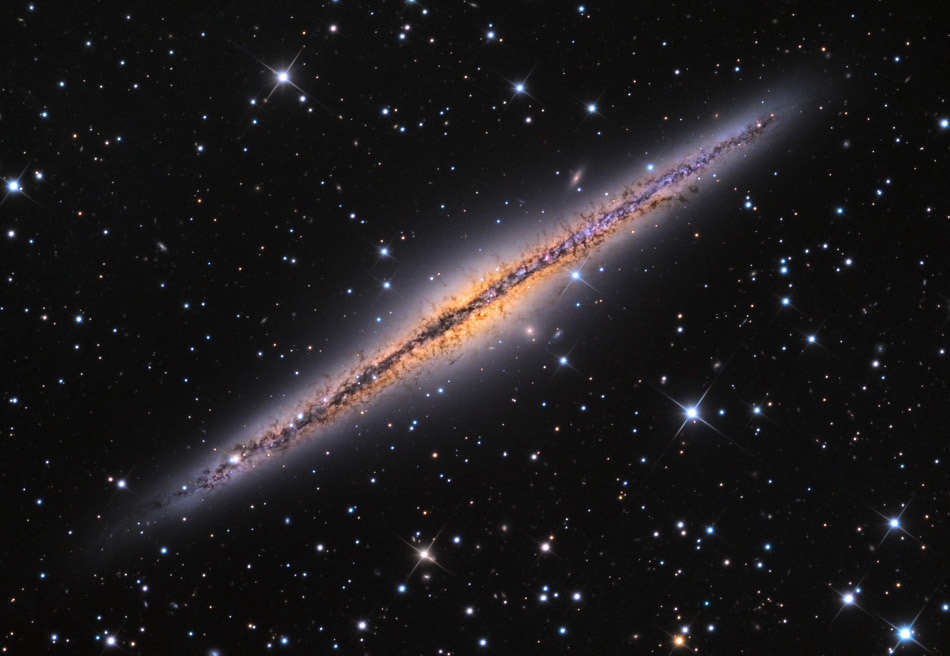Bildcredit und Bildrechte: Stephen Leshin
Es wirkt die Illustration in einer galaktischen Genau-so-Geschichte. Der Elefantenrüsselnebel windet sich im hohen, fernen Sternbild Kepheus im Emissionsnebel und jungen Sternhaufenkomplex IC 1396. Der kosmische Elefantenrüssel ist auch als vdB 142 bekannt. Er ist länger als 20 Lichtjahre.
Diese farbige Nahaufnahme enthält Bilddaten, die mit einem Schmalbandfilter aufgenommen wurden. Er ist für das Licht ionisierter Wasserstoffatome durchlässig. Das Ergebnis ist ein Kompositbild. Es betont die hellen, zurückgefegten Ränder um die Taschen aus kühlem interstellarem Staub und Gas. Solche eingebetteten, dunklen, rankenförmigen Wolken enthalten das Rohmaterial für Sternbildung. Manchmal verbergen sie im Inneren Protosterne.
Der relativ blasse Komplex IC 1396 ist fast 3000 Lichtjahre entfernt. Er bedeckt eine mehr als 5 Grad große Region am Himmel. Diese dramatische Szene zeigt ein 1 Grad großes Feld, es ist etwa so breit wie 2 Vollmonde.