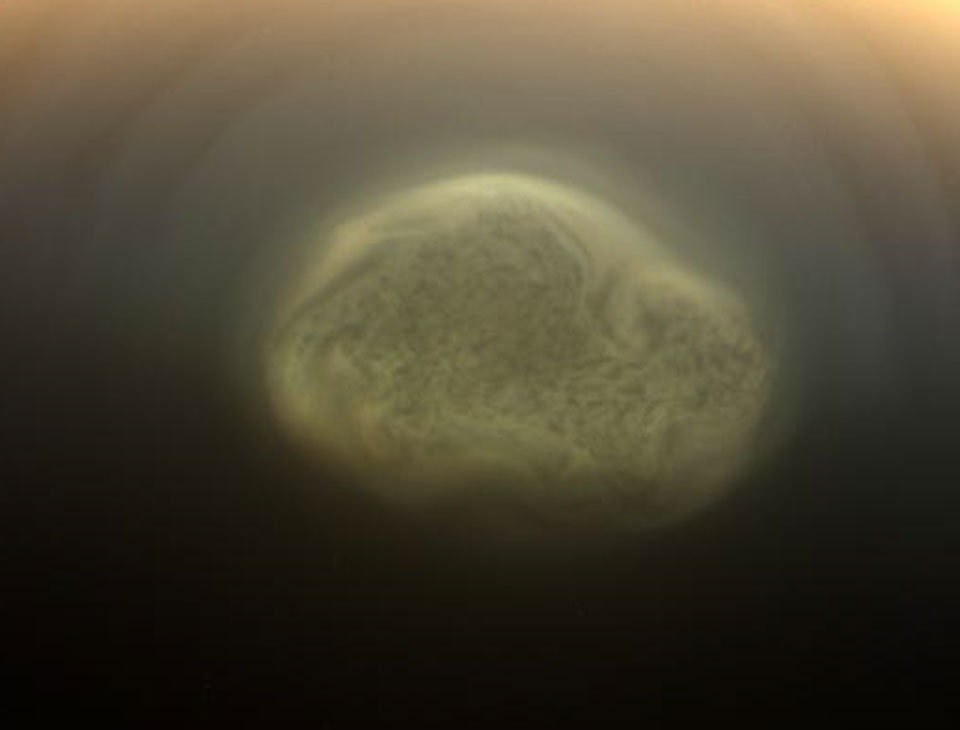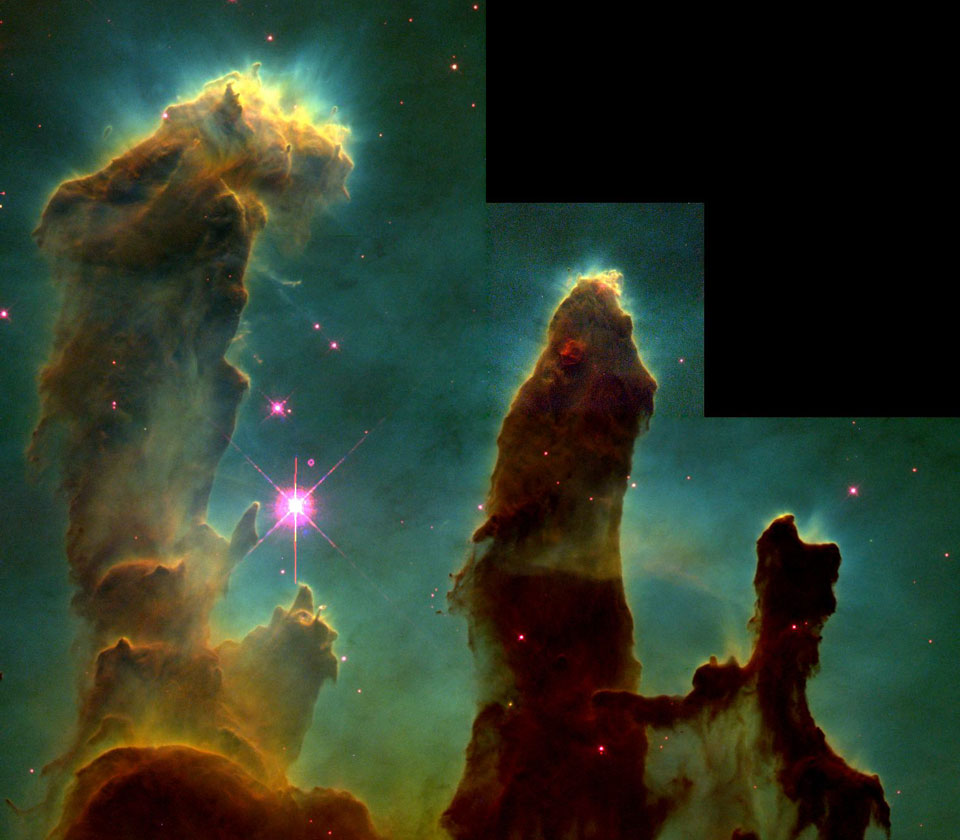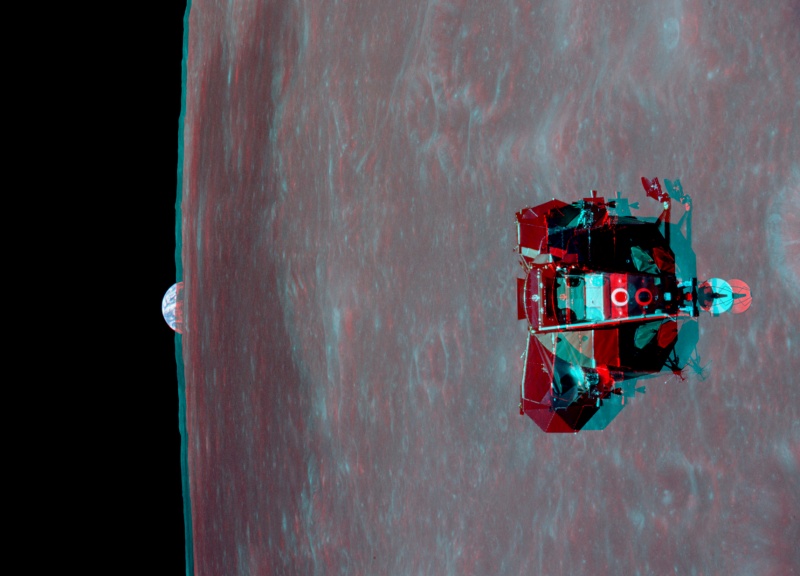Bild mit freundlicher Genehmigung der H.E.S.S.-Arbeitsgemeinschaft
Im Vordergrund dieses steht das High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) II-Teleskop. Es ist das größte seiner Art. Das Teleskop ist waagrecht geneigt und reflektiert die Landschaft der namibischen Wüste verkehrt herum. Der segmentierte Spiegel ist 24 Meter breit und 32 Meter hoch. Anders gesagt: Die Fläche ist so groß wie zwei Tennisplätze.
H.E.S.S. II ging am 26. Juli erstmals in Betrieb. Nun erforscht es das Universum in extremen Energien. Die meisten erdgebundenen Teleskope mit Linsen und Spiegeln werden durch die schützende Atmosphäre der Erde eingeschränkt. Die Lufthülle streut und absorbiert Licht und wirkt wie ein Weichzeichner für Bilder.
Doch H.E.S.S. II ist ein Tscherenkow-Teleskop. Es wurde gebaut, um Gammastrahlen zu beobachten. Das sind Photonen mit mehr als der 100-Milliarden-fachen Energie von sichtbarem Licht.
Für seine Beobachtungen braucht es die Atmosphäre sogar. Wenn Gammastrahlen auf die obere Atmosphäre treffen, erzeugen sie in der Luft Schauer aus sehr energiereichen Teilchen. Eine riesige Kamera im Brennpunkt des Spiegels zeichnet detailreich die kurzen Blitze im sichtbaren Licht auf. Es ist das sogenannte Tscherenkow-Licht, das durch die Teilchenschauer in der Luft entsteht.
Das H.E.S.S. II-Teleskop arbeitet künftig mit einer Anordnung von vier weiteren 12-Meter-Tscherenkow-Teleskopen zusammen. So entstehen mehrfache stereoskopische Ansichten der Luftschauer. Das lässt Rückschlüsse auf die Energien und die Richtungen der eintreffenden kosmischen Gammastrahlen zu.