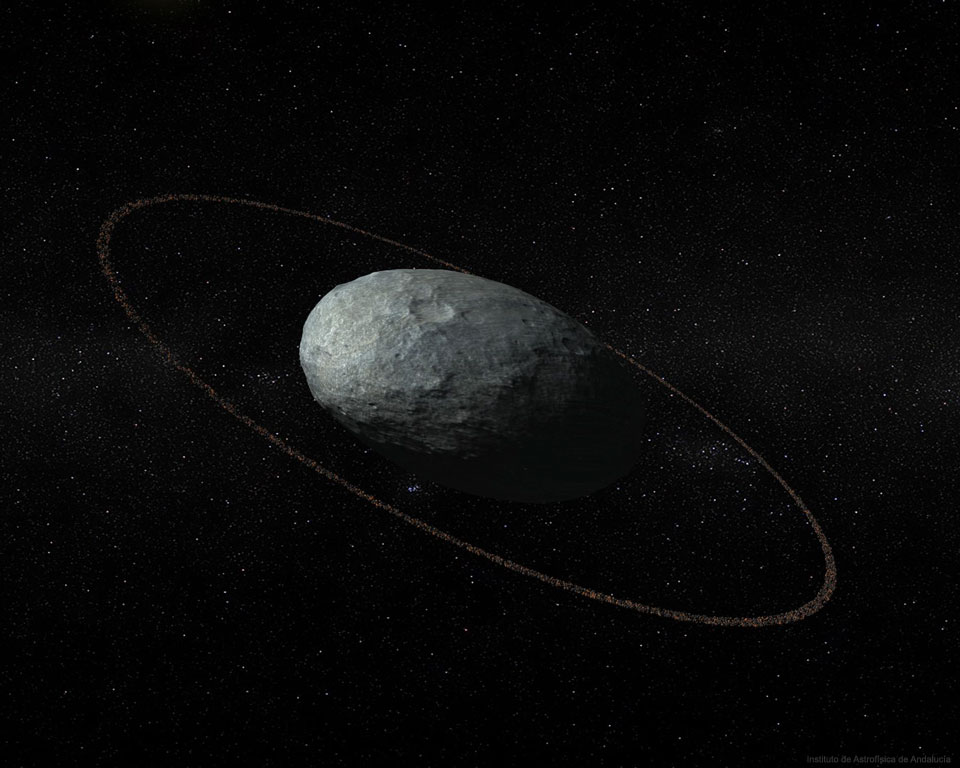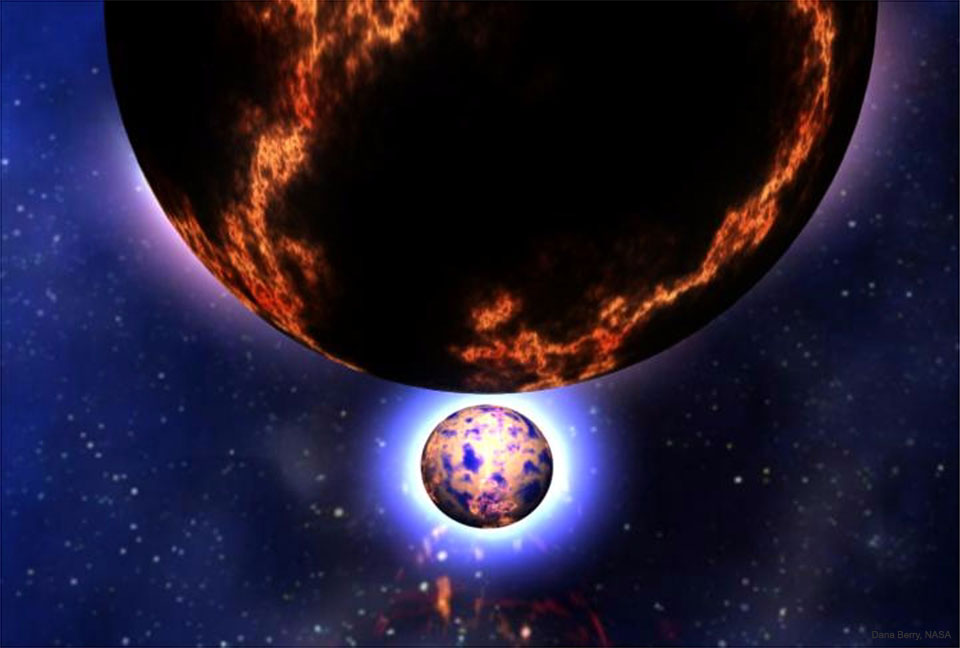Bildcredit und Bildrechte: Eric Coles und Martin Pugh
Beschreibung: Blaue Staubwolken und junge, energiereiche Sterne bevölkern diese Teleskoplandschaft, sie liegt weniger als 500 Lichtjahre entfernt an der nördlichen Grenze der Südlichen Krone (Corona Australis). Die Staubwolken blockieren wirksam das Licht der weiter entfernten Hintergrundsterne in der Milchstraße. Doch der auffällige Komplex aus Reflexionsnebeln, die als NGC 6726, 6727 und IC 4812 katalogisiert sind, erzeugt eine charakteristische blaue Farbe, wenn das Licht der hellen, blauen Sterne in der Region von kosmischem Staub reflektiert wird. Der Staub verdeckt auch Sterne, die sich noch im Entstehungsprozess befinden. Links biegt sich der kleinere gelbliche Nebel NGC 6729 um den jungen veränderlichen Stern R Coronae Australis. Die darunter liegenden leuchtenden Bögen und Schleifen, welche durch die Ausflüsse eingebetteter, neu entstandener Sterne komprimiert wurden, werden als Herbig-Haro-Objekte bezeichnet. Am Himmel umfasst dieses Sichtfeld etwa ein Grad, das entspricht in der ermittelten Entfernung der nahen Sternbildungsregion fast neun Lichtjahren.
Erforsche das Universum: APOD-Zufallsgenerator
Zur Originalseite