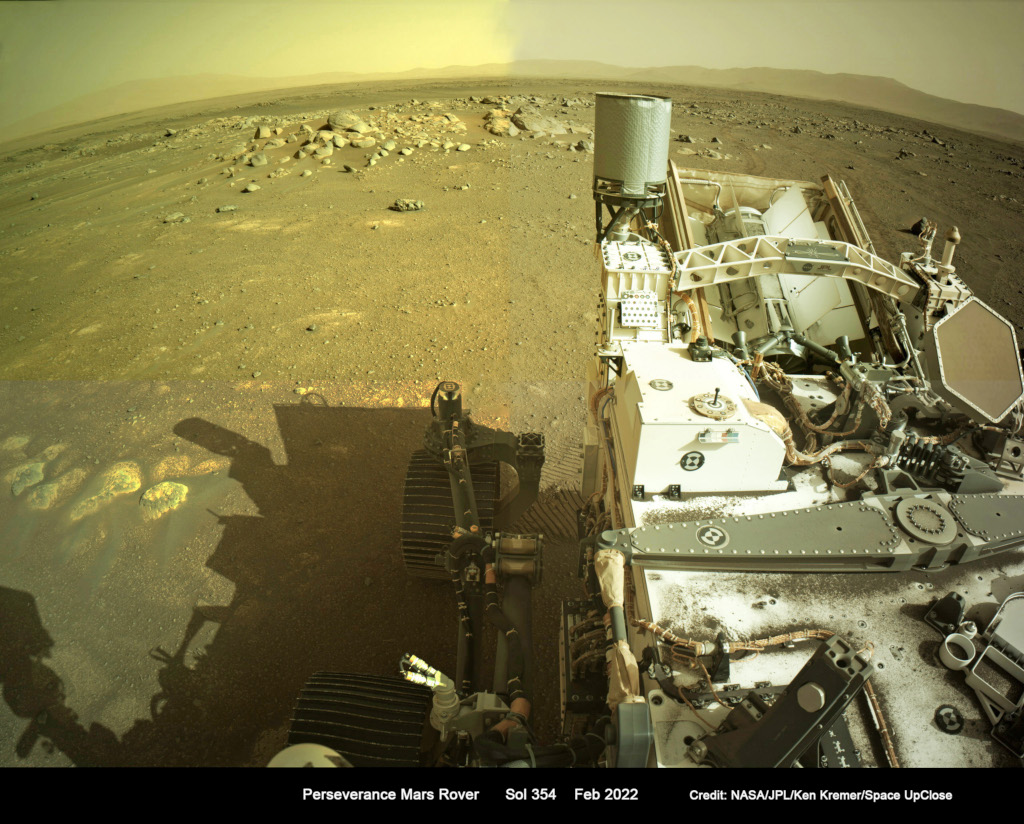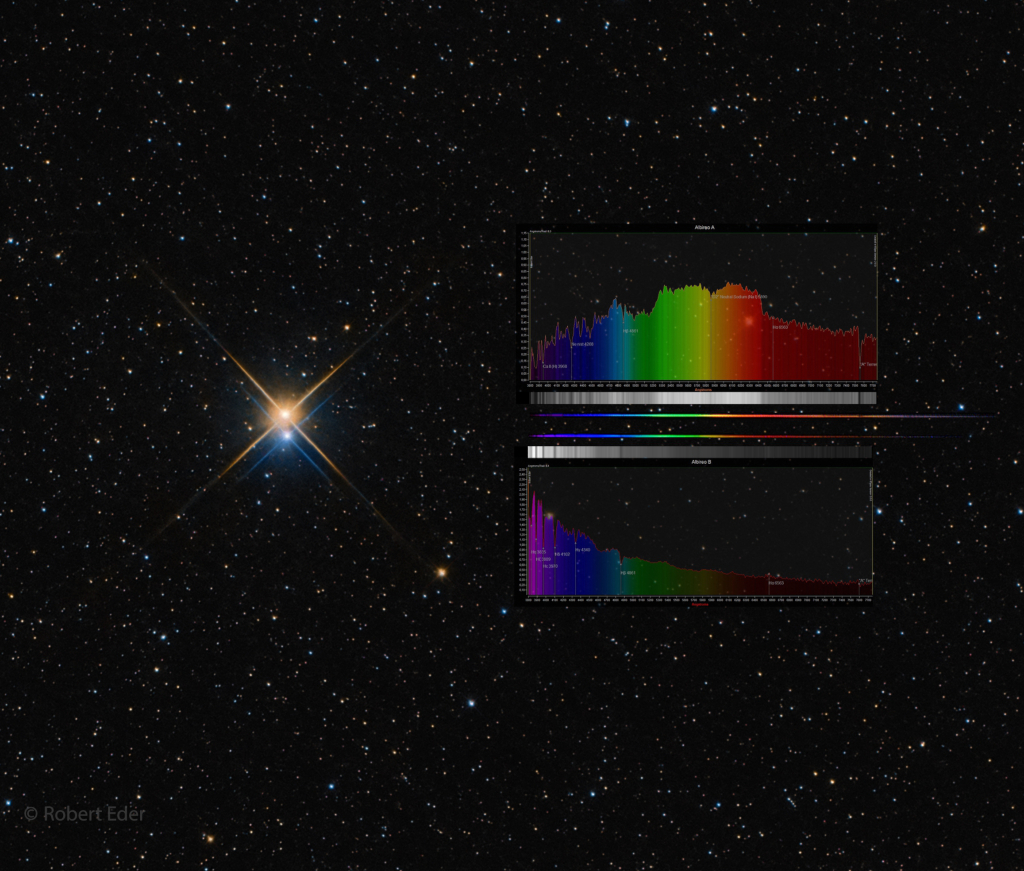Bildcredit und Bildrechte: Jeff Graphy
Beschreibung: Man muss nicht durch ein Teleskop sehen, um zu wissen, wohin es zeigt. Mit einem Teleskop kann man ein Bild auf eine große Fläche projizieren. Das kann nützlich sein, weil es die intensive Lichtfülle sehr heller Quellen abschwächt. So eine Abdunklung hilft, um die Sonne zu betrachten, zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis.
Bei diesem Einzelbild wird jedoch ein heller Vollmond projiziert. Vor zwei Wochen war der Vollmond im Februar, den manche nördlichen Kulturen Schneemond nennen. Das Projektionsinstrument ist das 62-Zentimeter-Hauptteleskop des Observatoriums von Saint-Véran hoch oben in den französischen Alpen.
Einen Vollmond direkt zu sehen ist einfach, weil er nicht zu hell ist, doch dann seht ihr nicht diesen Detailreichtum. Die nächste Gelegenheit kommt am 17. März.
Wien, Ladenkonzept Nähe Votivkirche: Kostenlose Kalender (leichte Mängel)