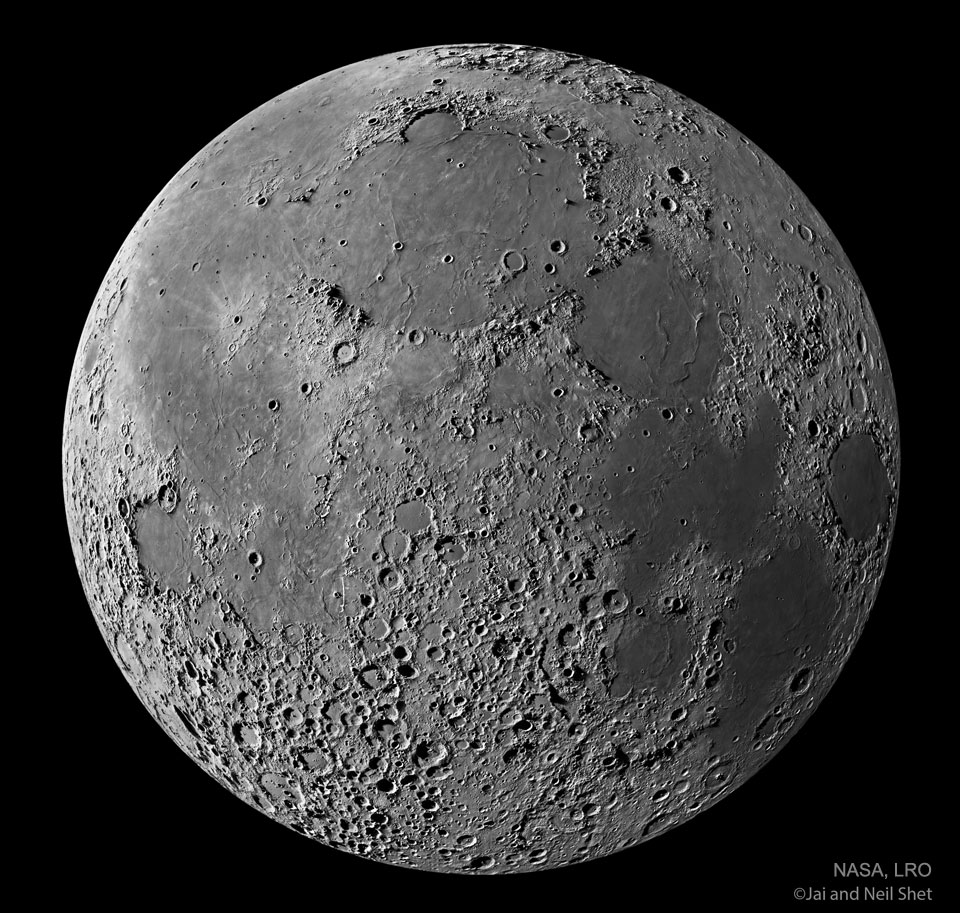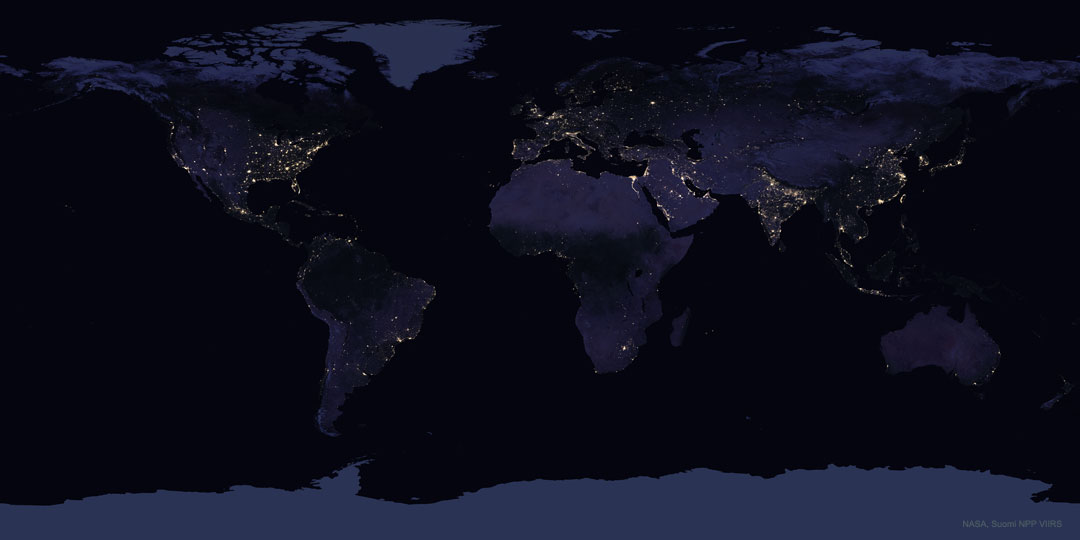Bildcredit und Bildrechte: Robert Howell
Beschreibung: Manchmal brechen Himmel und Erde aus. Vor wenigen Jahren brachen unerwartet farbenprächtige Polarlichter aus, mit grünen Polarlichtern nahe am Horizont, und hoch oben blühten gleißend rote Polarlichtbänder. Ein heller Mond beleuchtete den Vordergrund der malerischen Szene, während in weiter Ferne vertraute Sterne glitzerten.
Ein gewissenhafter Astrofotograf schoss dieses gut geplante Bildmosaik auf dem Gelände des White-Dome-Geysirs im Yellowstone-Nationalpark im Westen der USA. Tatsächlich brach kurz nach Mitternacht der White Dome aus und sprühte eine viele Meter hohe Fontäne aus Wasser und Dampf in die Luft.
Das Wasser eines Geysirs wird mehrere Kilometer unter der Oberfläche von glühend heißem Magma zu Dampf erhitzt und steigt durch Felsspalten zur Oberfläche auf. Etwa die Hälfte aller bekannten Geysire befinden sich im Yellowstone-Nationalpark. Der geomagnetische Sturm, der die Polarlichter verursachte, ebbte innerhalb eines Tages ab, doch die Eruptionen des White-Dome-Geysirs treten weiterhin etwa alle 30 Minuten auf.
Wien, 26. Februar 2022, 18h: Führung im Sterngarten Mauer mit APOD-Übersetzerin
Wien, Ladenkonzept Nähe Votivkirche: Kostenlose Kalender (leichte Mängel)