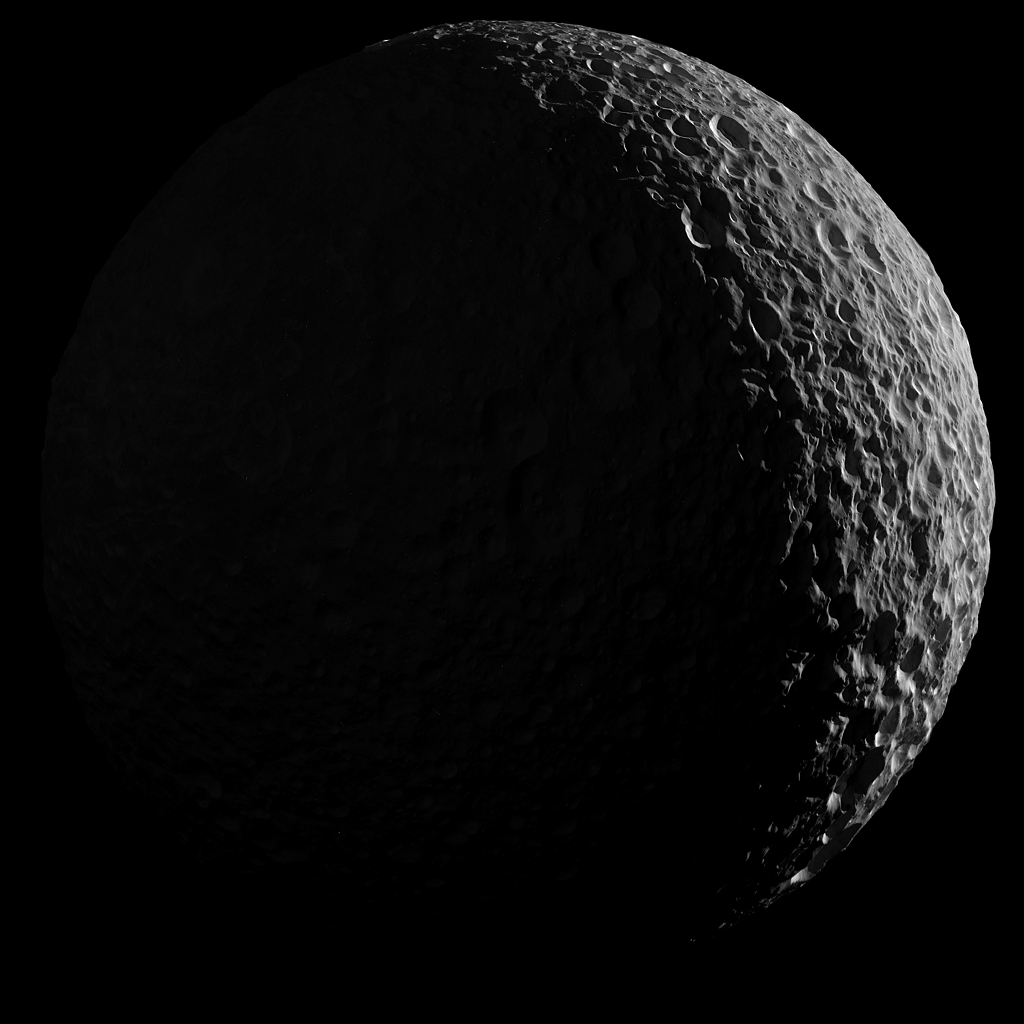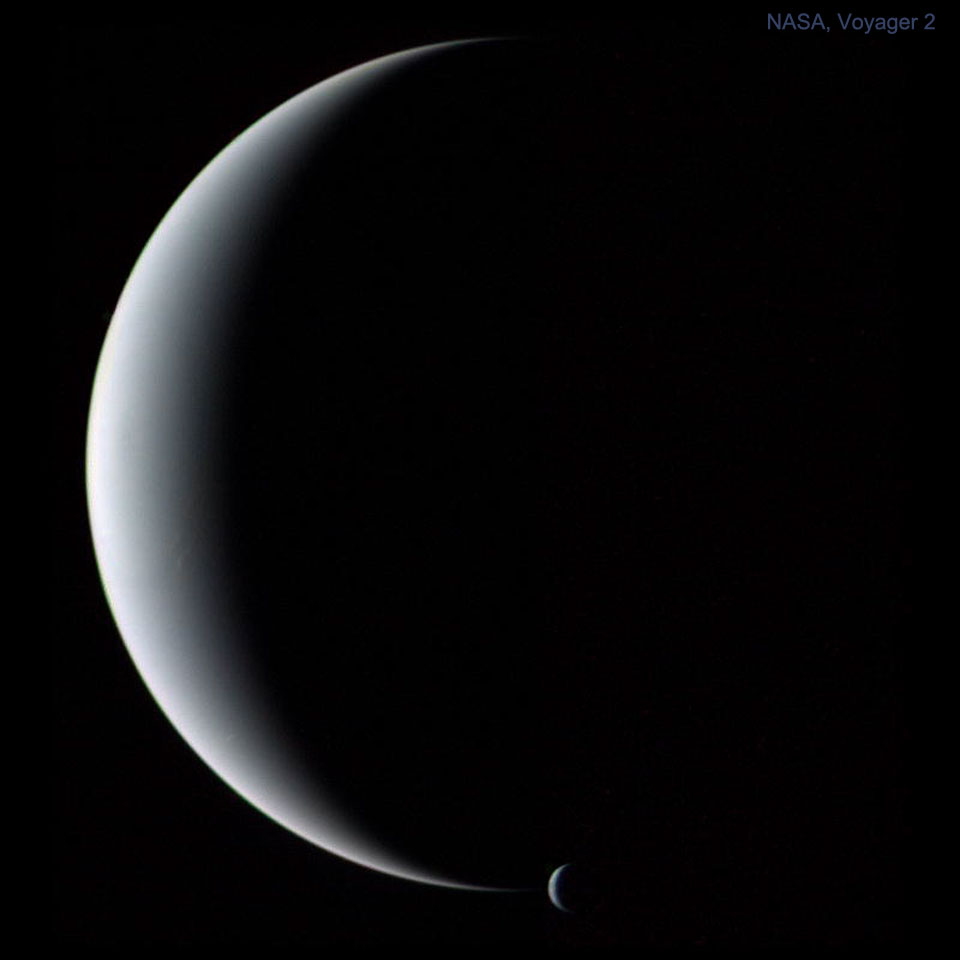Bildcredit und Bildrechte: Petr Horalek / Institut für Physik Opava
Beschreibung: Erinnert ihr euch an letzten Juli? Unter den Sternen des Großen Wagens war der Komet NEOWISE am Abendhimmel zu sehen. Nach Sonnenuntergang konnte man auf der Nordhalbkugel den Kometen, der mit bloßem Auge sichtbar war, über dem nordwestlichen Horizont unter dem Kasten des berühmten Himmelswagens suchen.
Der Komet wirkte wie ein diffuser „Stern“ mit Schweif, vielleicht nicht so lang wie auf dieser unvergesslichen Himmelsansicht vom 23. Juli 2020 aus der Tschechischen Republik, die etwa zur größten Annäherung des Kometen an den Planeten Erde fotografiert wurde. Fotos des Kometen C/2020 F3 (NEOWISE) zeigen häufig den breiten Staubschweif und den blassen, aber getrennten bläulichen Ionenschweif des Kometen, der weiter reichte, als man mit bloßem Auge sehen konnte. Weltweit waren Himmelsbeobachterinnen begeistert vom Kometen NEOWISE, dem Überraschungsbesucher aus dem äußeren Sonnensystem.
Prächtige Bilder des Kometen NEOWISE 2020: 31., 30., 29., 28., 27., 26., 25. und 24. Juli