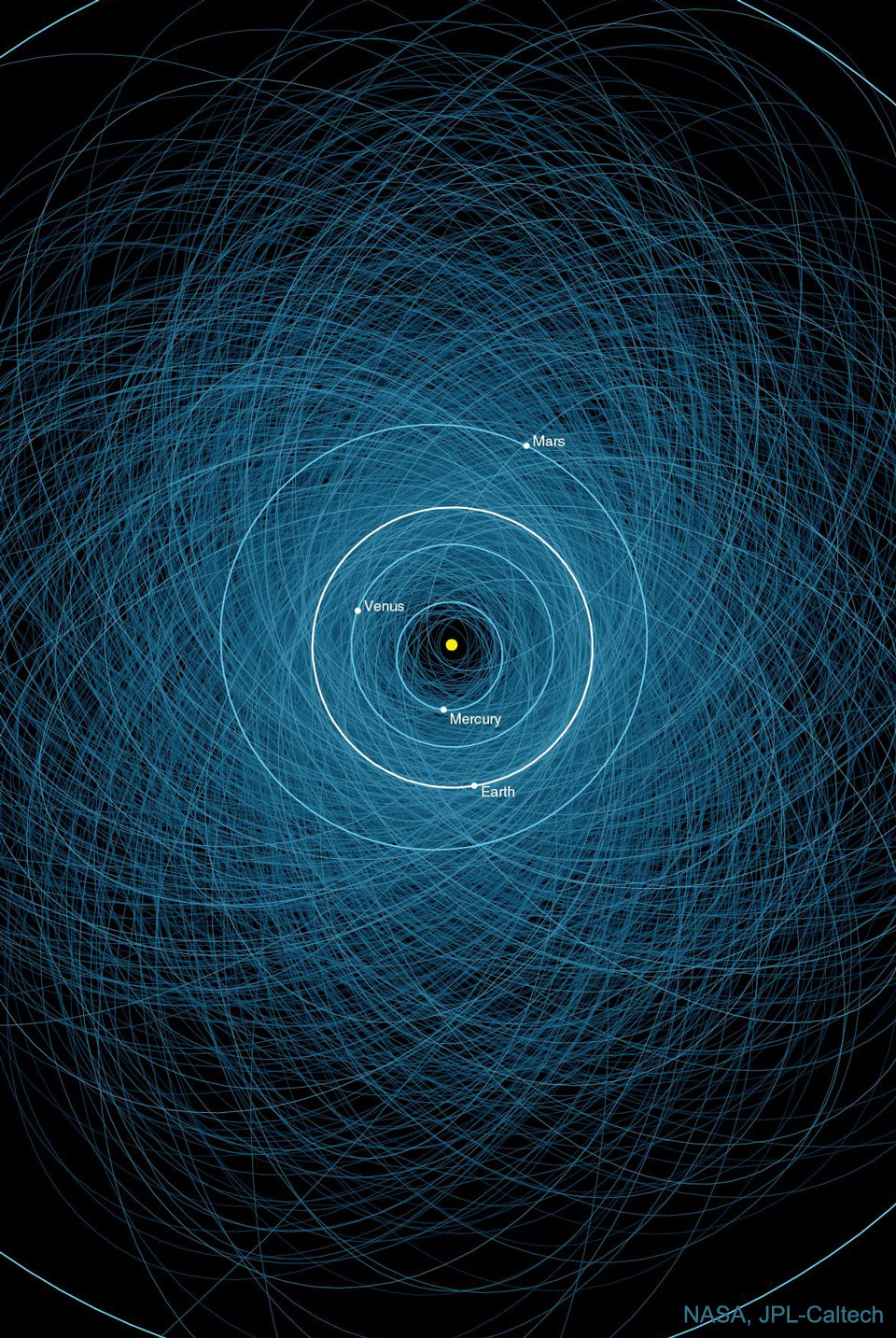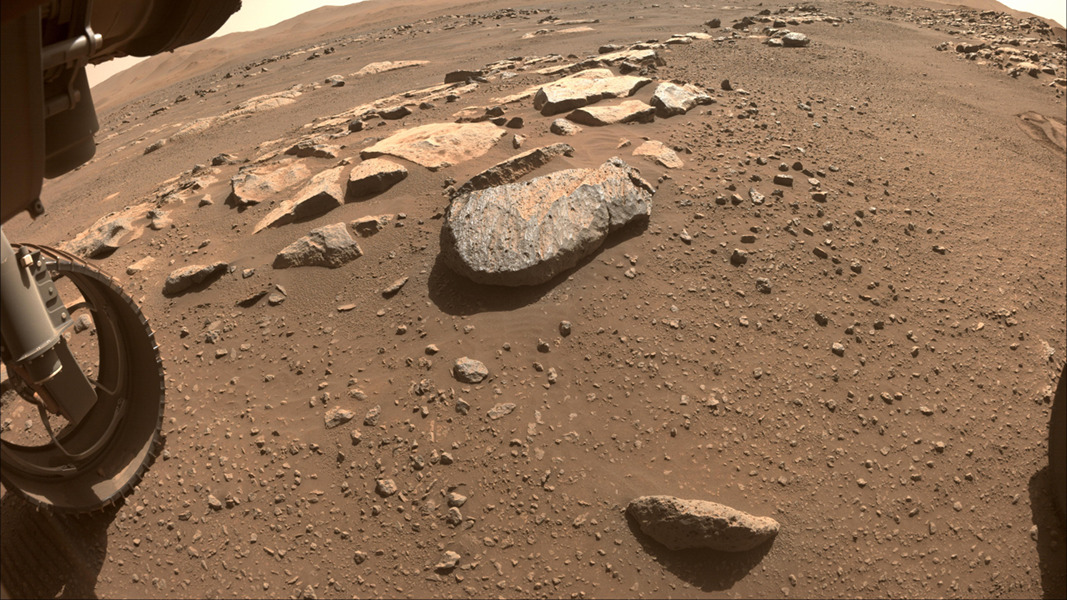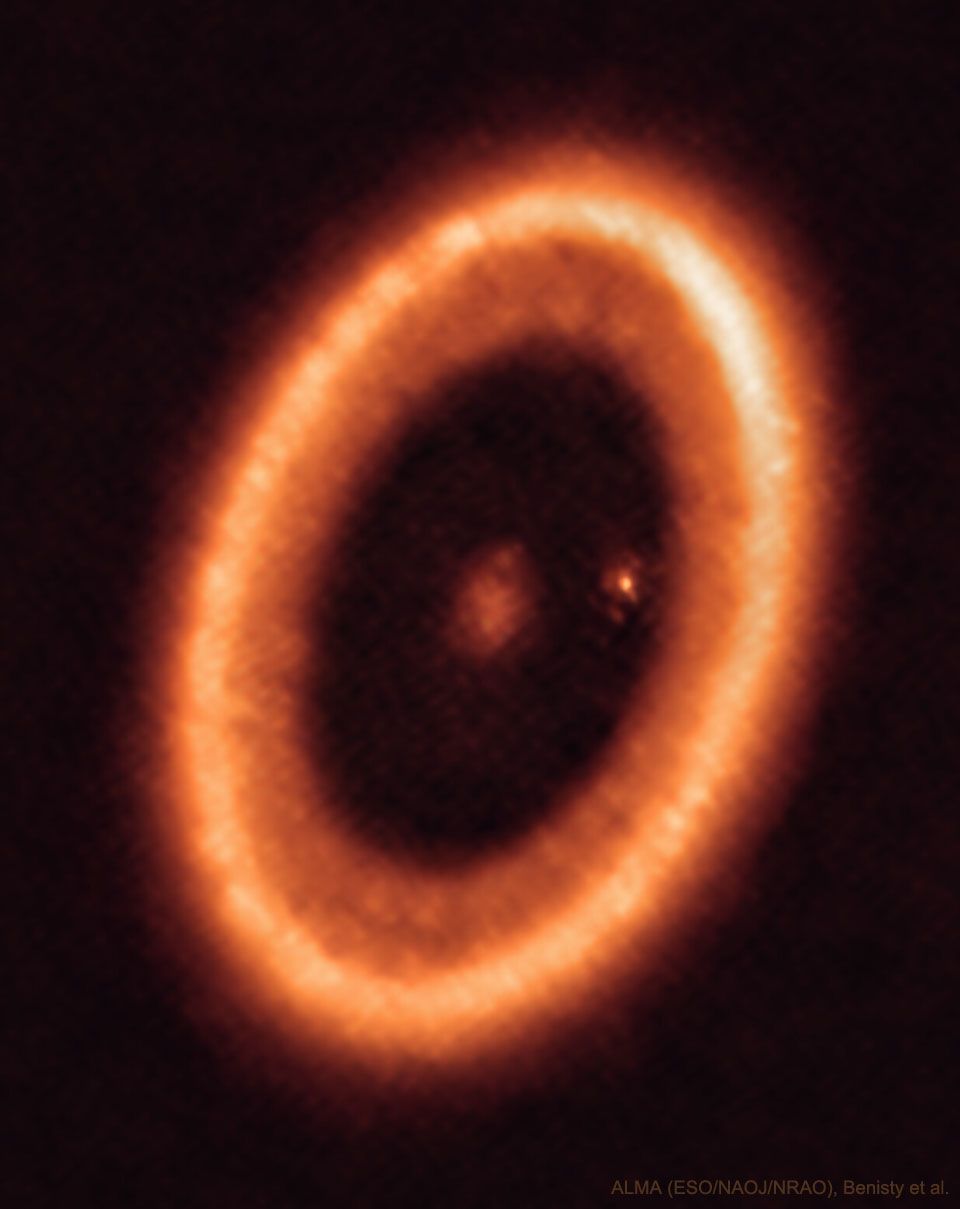Bildcredit und Bildrechte: Robert Fedez
Beschreibung: Der Mond leuchtet normalerweise in zarten Grau- oder Goldtönen. Für diese vielfarbige Teleskop-Mondlandschaft zur vollen Mondphase wurden kleine, aber messbare Farbunterschiede kräftig verstärkt. Man geht davon aus, dass die verschiedenen Farben den tatsächlichen Unterschieden der chemischen Zusammensetzung der Mondoberfläche entsprechen. Blaue Farbtöne zeigen titanreiche Regionen, während orange und violette Farbtöne relativ titan- und eisenarme Regionen sind.
Das vertraute Meer der Ruhe oder Mare Tranquillitatis ist die blaue Region rechts oben. Vom 85 Kilometer großen Strahlenkrater Tycho rechts unten verlaufen weiße Linien strahlenförmig über die orange gefärbten südlichen lunaren Hochländer.
Der Vollmond zu Beginn des Monats wird als jahreszeitlicher Blauer Mond gezählt, weil er ungewöhnlicherweise der dritte von vier Vollmonden war, die während des nördlichen Sommers (und somit des südlichen Winters) auftraten. Dieses Komposit aus 272 Bildern zeigt, dass der Vollmond immer blau ist, aber nicht sosehr, dass er beeindruckt.
Fast Hyperraum: APOD-Zufallsgenerator