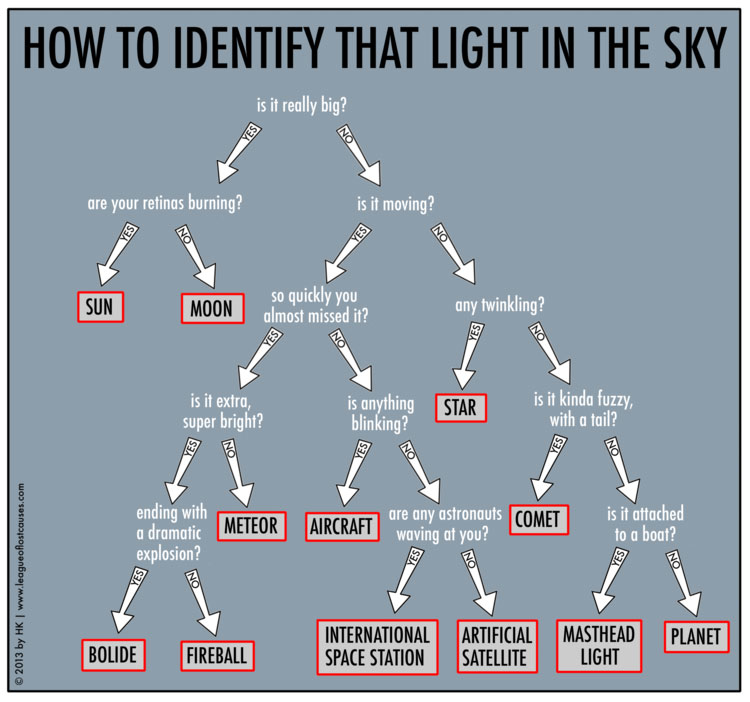Bildcredit und Bildrechte: Alessandro Merga
Dieses astronomische Reisefoto entstand in einer Boeing 747. Helle Sterne im Schützen und das Zentrum der Milchstraße liegen hinter dem Flügel. Die Szenerie aus der Stratosphäre entstand Anfang des Monats bei einem Flug von New York nach London. Sie wurde 11.0000 Meter über dem Atlantik fotografiert.
Natürlich war der Himmel in dieser Höhe klar und dunkel – ideale Bedingungen für Astrofotografie. Doch es war schwierig, durch ein Passagierfenster des Flugzeugs zu fotografieren, das mit fast 1000 Kilometern pro Stunde dahinflog.
Mit einem lichtstarken Objektiv, sorgfältiger Kameraeinstellung und einem kleinen, flexiblen Stativ entstanden mehr als 90 Aufnahmen. Jede war 30 Sekunden oder weniger belichtet. Ein Tuch schirmte die Reflexionen der Innenbeleuchtung ab. Am Ende entstand eine 10-Sekunden-Belichtung, ein stabiles, farbiges Beispiel der Luftfahrtastronomie.