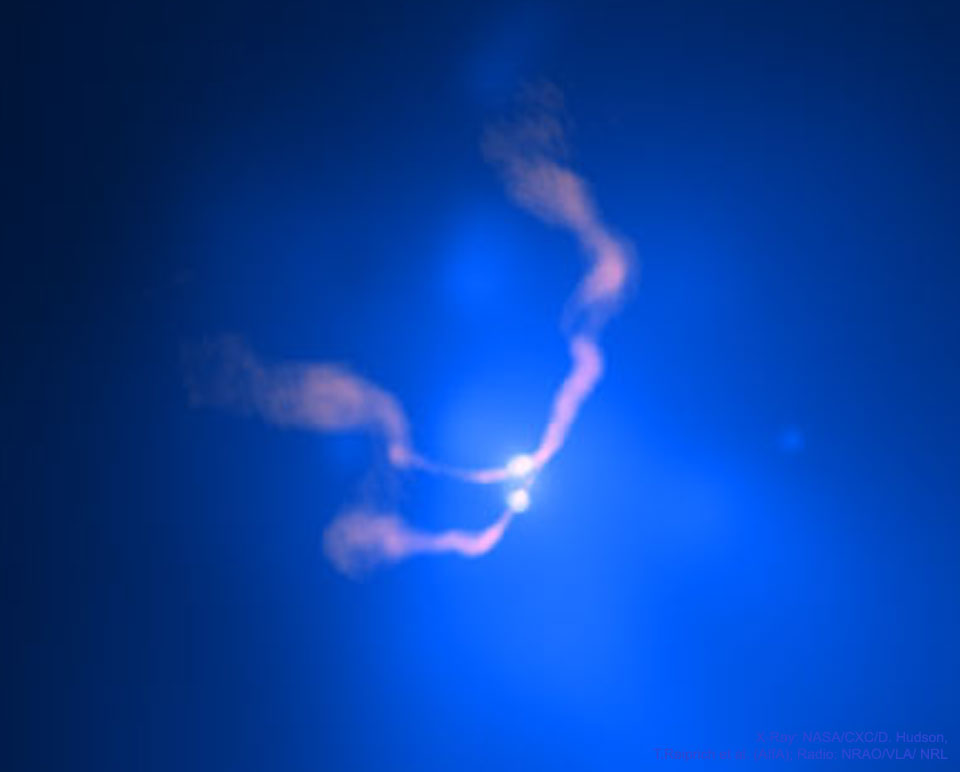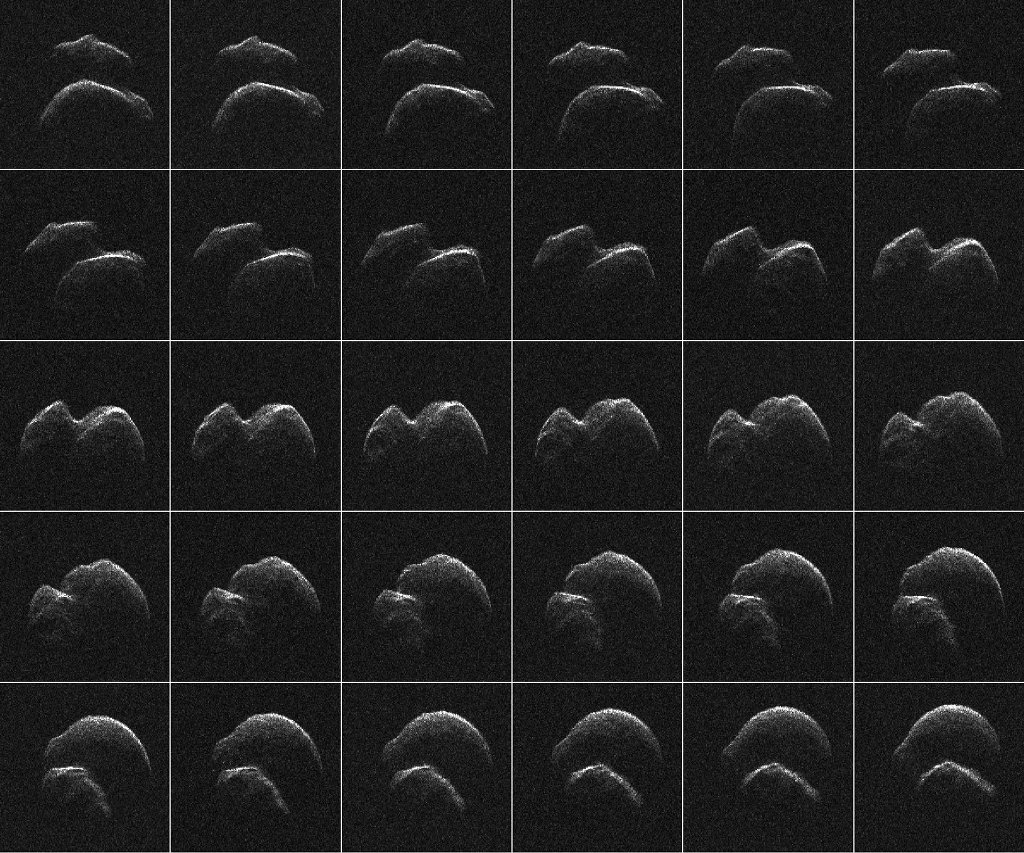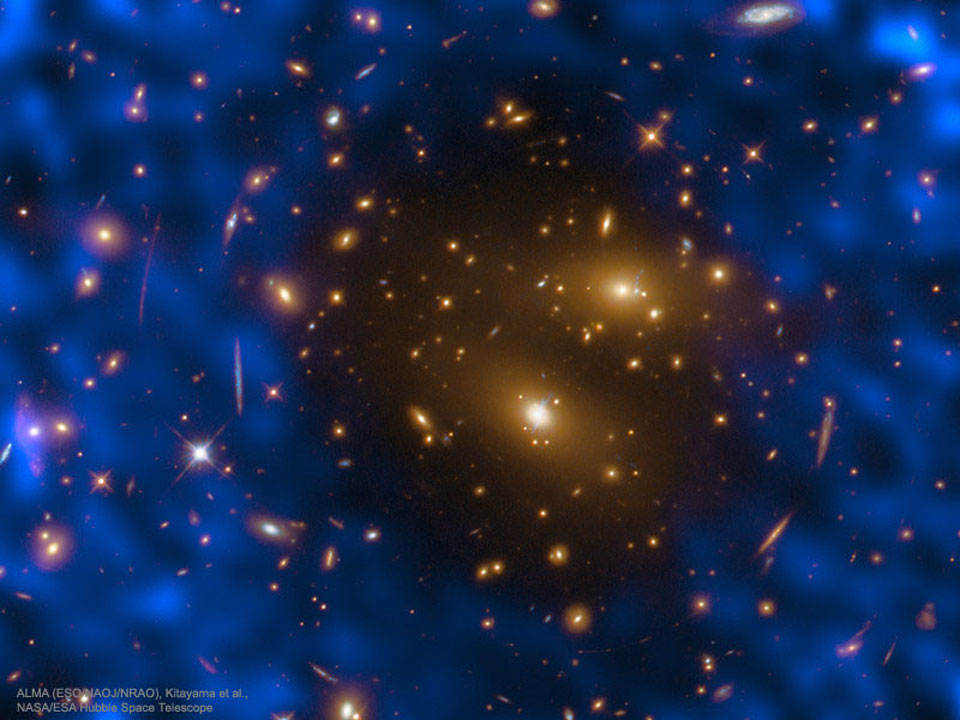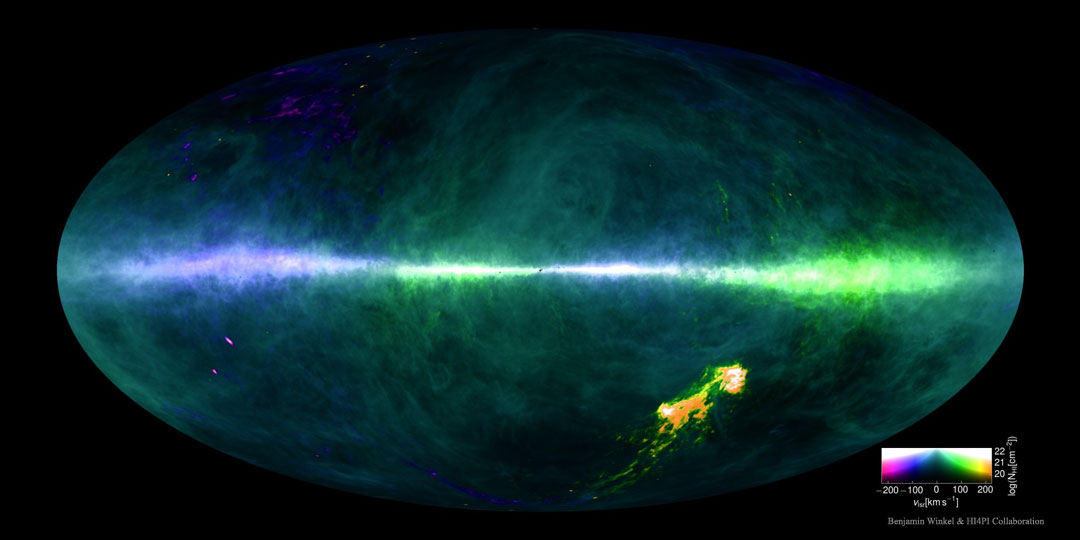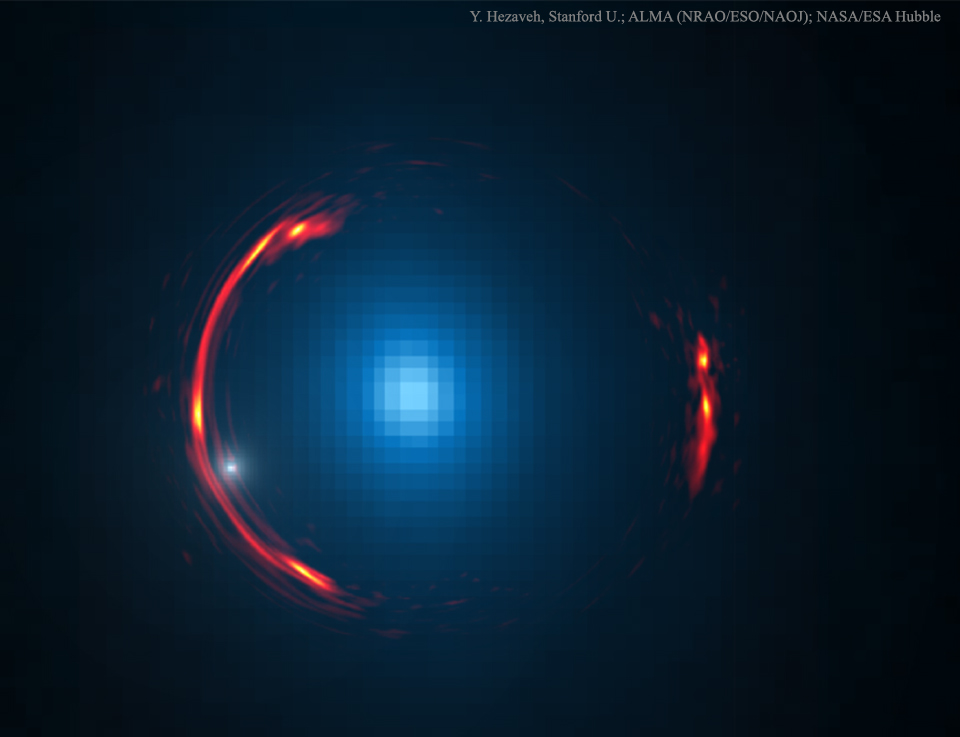Bildcredit und Bildrechte: Yin Hao
Jedes Jahr trifft der Meteorstrom der Geminiden die Erde. Er enttäuschte nicht, als unser Planet durch Staub des aktiven Asteroiden 3200 Phaethon pflügte. Diese Nachtlandschaft wurde auf der Nordhalbkugel fotografiert. Darauf strömen die Meteore vom Radianten des Meteorstroms aus, der im Sternbild Zwillinge liegt.
In der Nacht von 12. auf 13. Dezember entstanden in einem Zeitraum von 8,5 Stunden 37 Einzelbilder mit den Spuren von Meteoren. Sie wurden zu diesem Kompositbild kombiniert. Dazu wurden die einzelnen Bilder am sternklaren Himmel ausgerichtet. Er breitete sich über einer Radioantenne von MUSER aus. Die Radioteleskope von MUSER gehören zur Station Mingantu, deren Name einen astronomischen Hintergrund hat. Sie dienen der Beobachtung der Sonne. Die Anlage steht in der Inneren Mongolei in China und ist ungefähr 400 Kilometer von Peking entfernt.
Sirius leuchtet hell über der Radioschüssel. Er ist der Alphastern im Großen Hund (Canis Major). Die Milchstraße reicht von dort bis zum Zenit. Der gelbliche Stern Beteigeuze steht rechts neben der nördlichen Milchstraße. Er ist ein Blickfang im Orion. Der Radiant der Sternschnuppen liegt links oben bei Kastor und Pollux. Sie sind die Zwillingssterne in Gemini. Der Radianteffekt entsteht durch die Perspektive. Die Meteorbahnen laufen parallelen. Scheinbar treffen sie sich in der Ferne. Die Meteore der Geminiden treten mit etwa 22 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein.