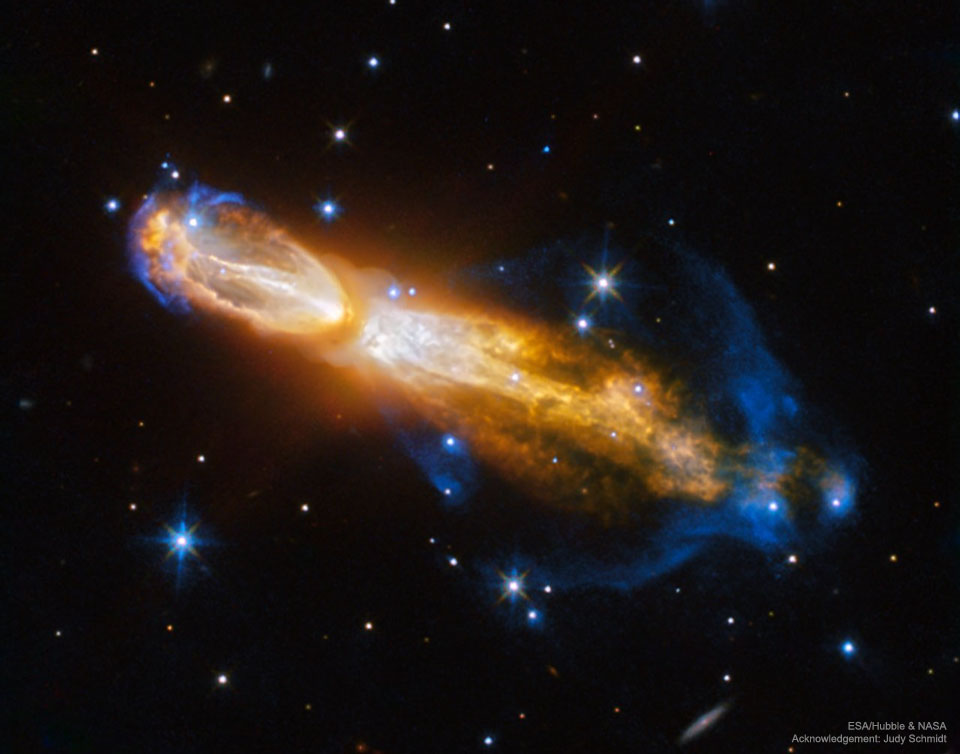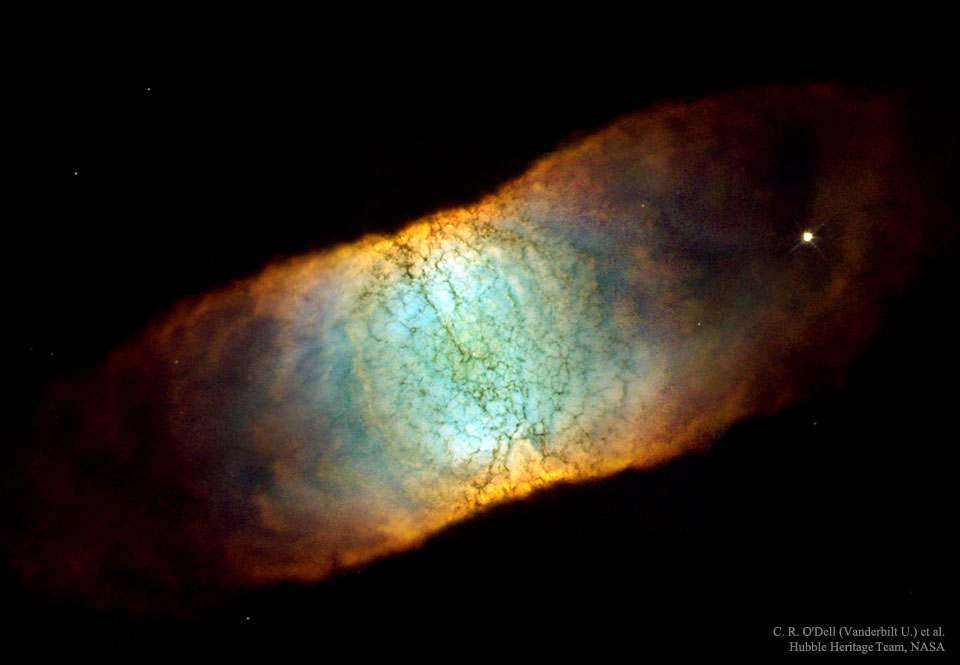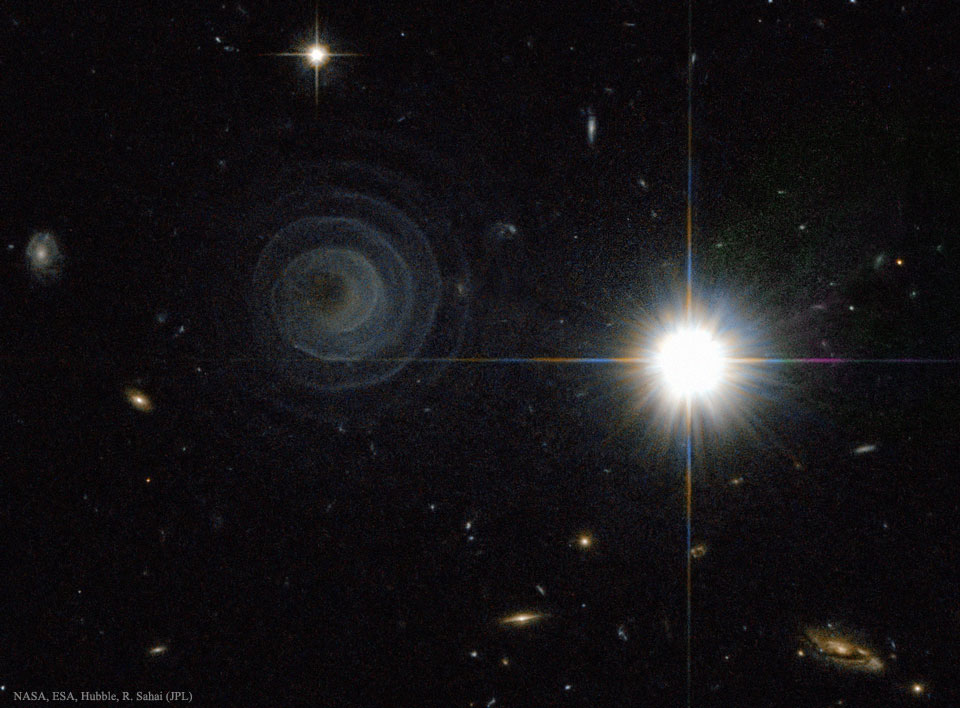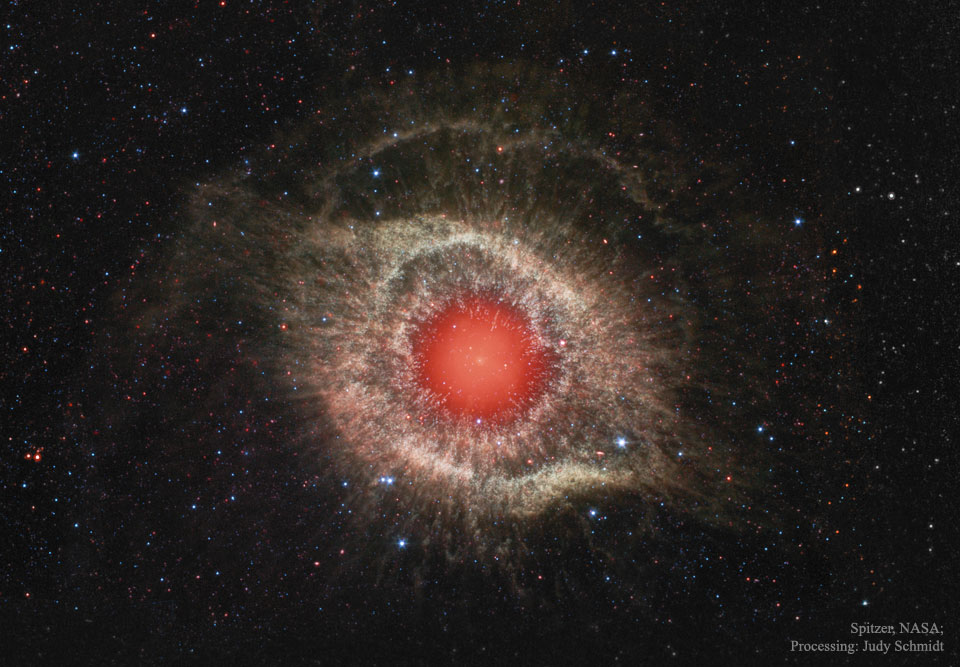Bildcredit und Bildrechte: Barry Riu
Komet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak posierte für einen Messieraugenblick. Er teilt das 1 Grad breite Sichtfeld mit zwei bekannten Einträgen im berühmten Katalog aus dem 18. Jh. eines Astronomen, der Kometen jagte. Der Schnappschuss entstand am 21. März mit Teleskop.
Der blasse grünliche Komet zieht knapp unter dem Großen Wagen über den nördlichen Frühlingshimmel. Er war zirka 75 Lichtsekunden von unserem hübschen Planeten entfernt. Die staubige Spiralgalaxie Messier 108 (unten in der Mitte) ist von der Seite sichtbar. Sie ist an die 45 Millionen Lichtjahre entfernt. Der planetarische Nebel rechts oben ist der eulenartige Messier 97. Der Nebel hat einen alternden, aber sehr heißen Zentralstern. Er ist nur etwa 12.000 Lichtjahre entfernt und liegt in unserer Milchstraße.
Dieser blasse periodische Komet ist nach seinem Entdecker und Wiederentdecker benannt. Er wurde erstmals 1858 gesichtet und dann erst wieder 1907 und 1951. Die Berechnung seiner Bahn ließ den Schluss zu, dass derselbe Komet in großen Zeitabständen beobachtet wurde. Komet 41P nähert sich am 1. April seiner besten Sichtbarkeit und der größten Annäherung an die Erde seit mehr als 100 Jahren. Er umrundet die Sonne etwa alle 5,4 Jahre.