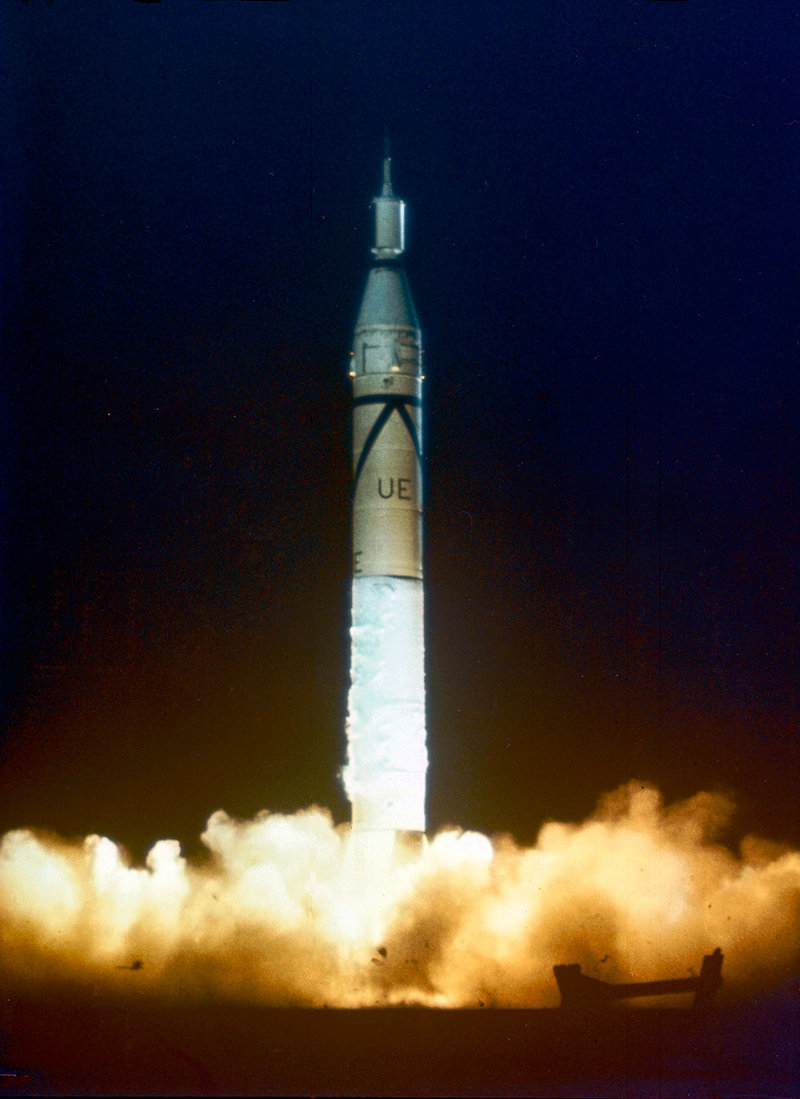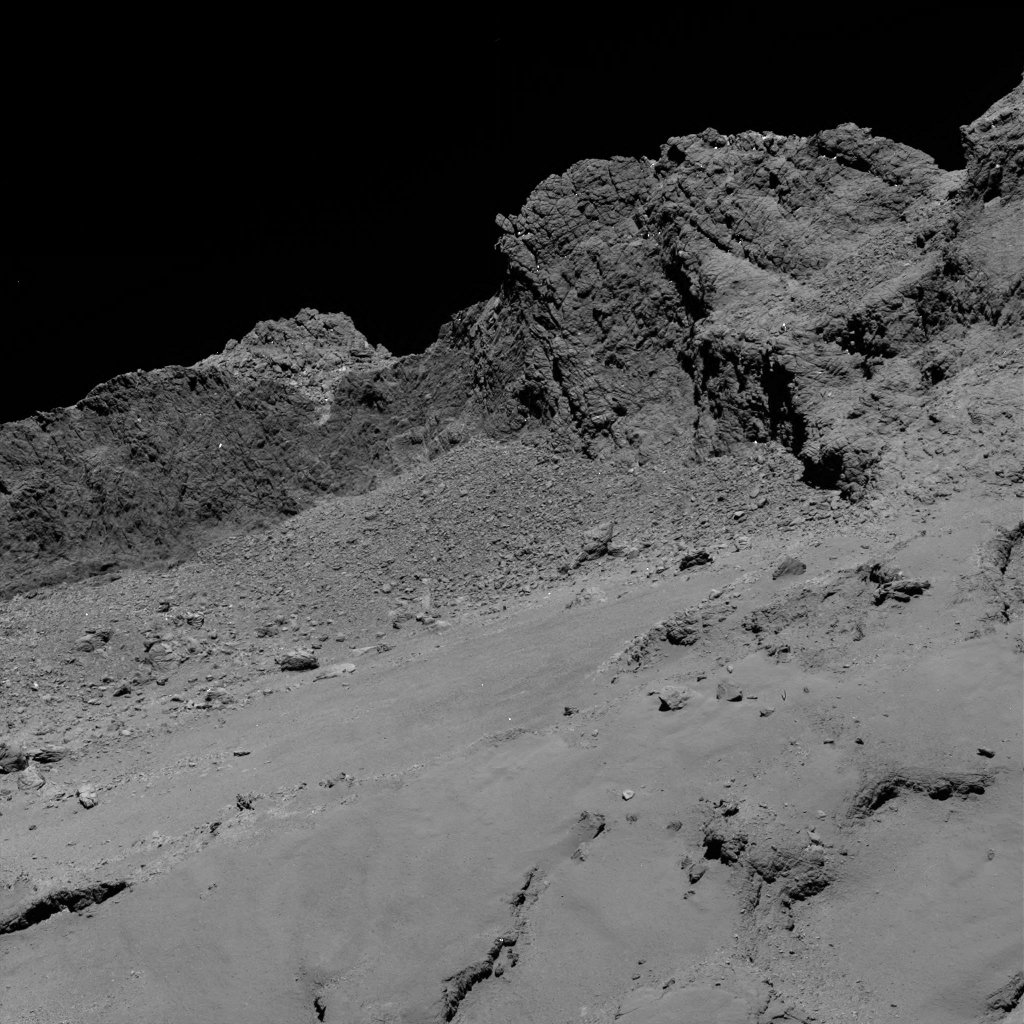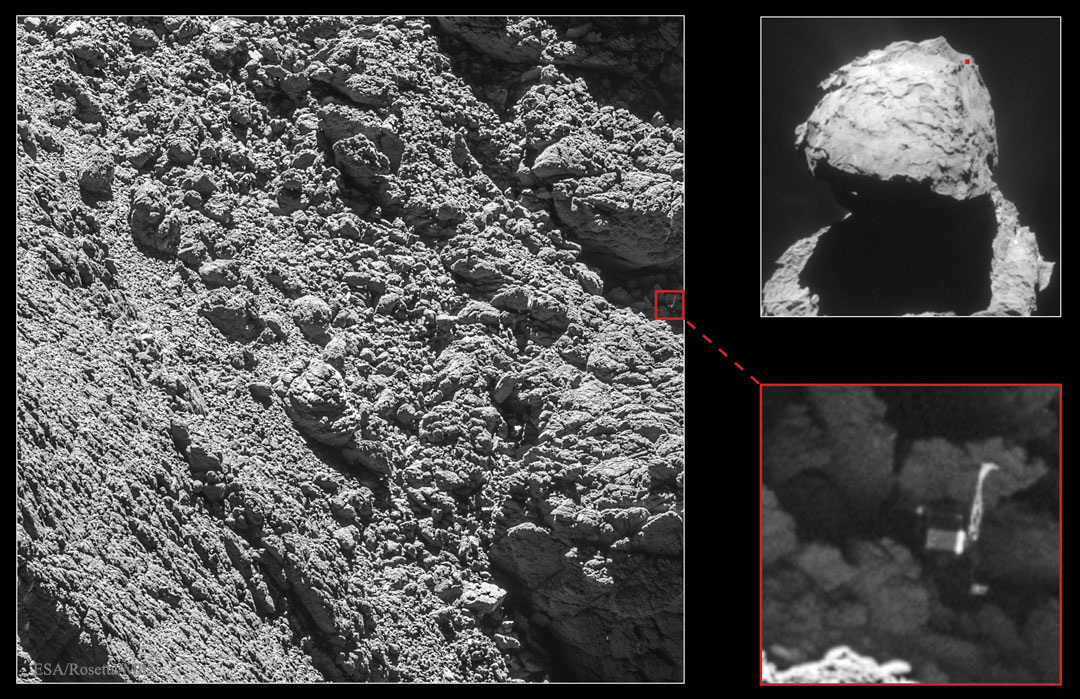Bildcredit: Dbachmann, Wikipedia
Beschreibung: Sie ist vermutlich die älteste bekannte Darstellung des Nachthimmels. Doch was genau zeigt sie, und warum wurde sie hergestellt?
Die Himmelsscheibe wurde 1999 von Schatzsuchern mit einem Metalldetektor in der Nähe von Nebra (Deutschland) inmitten mehrerer Waffen aus der Bronzezeit gefunden. Das urzeitliche Artefakt ist zirka 30 Zentimeter groß und wurde der Aunjetitzer Kultur zugeordnet, die 1600 v. Chr. Teile von Europa bewohnte.
Bei der Rekonstruktion wird angenommen, dass die Punkte Sterne und der Sternhaufen die Plejaden darstellen, der große Kreis und der Halbmond symbolisieren vermutlich Sonne und Mond. Der Zweck der Scheibe bleibt unbekannt – einige Hypothesen vermuten eine astronomische Uhr, ein Kunstwerk oder ein religiöses Symbol. Ihr Wert beträgt ungefähr 8,9 Millionen Euro, manche glauben, die Himmelsscheibe von Nebra wäre nur eine von zweien, und die zweite warte noch auf ihre Entdeckung.