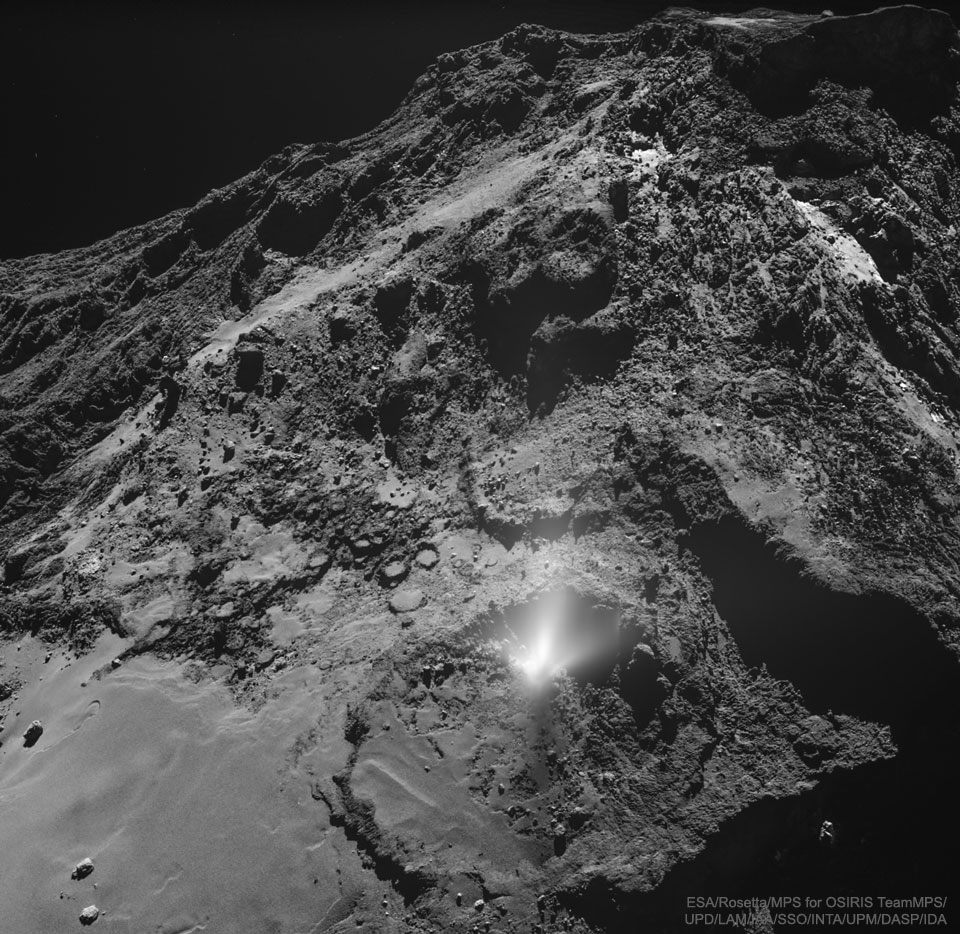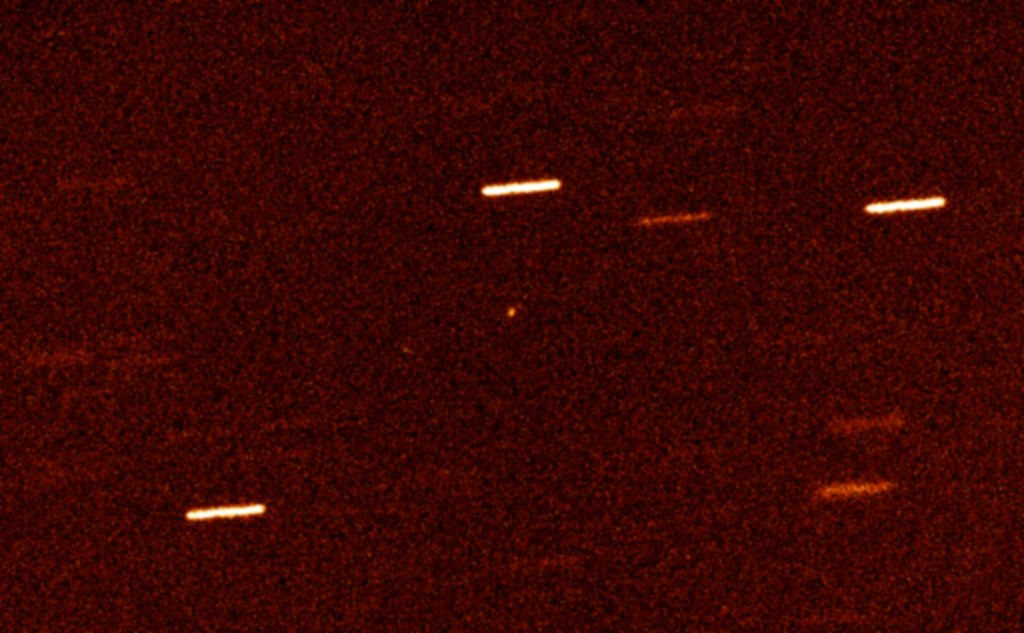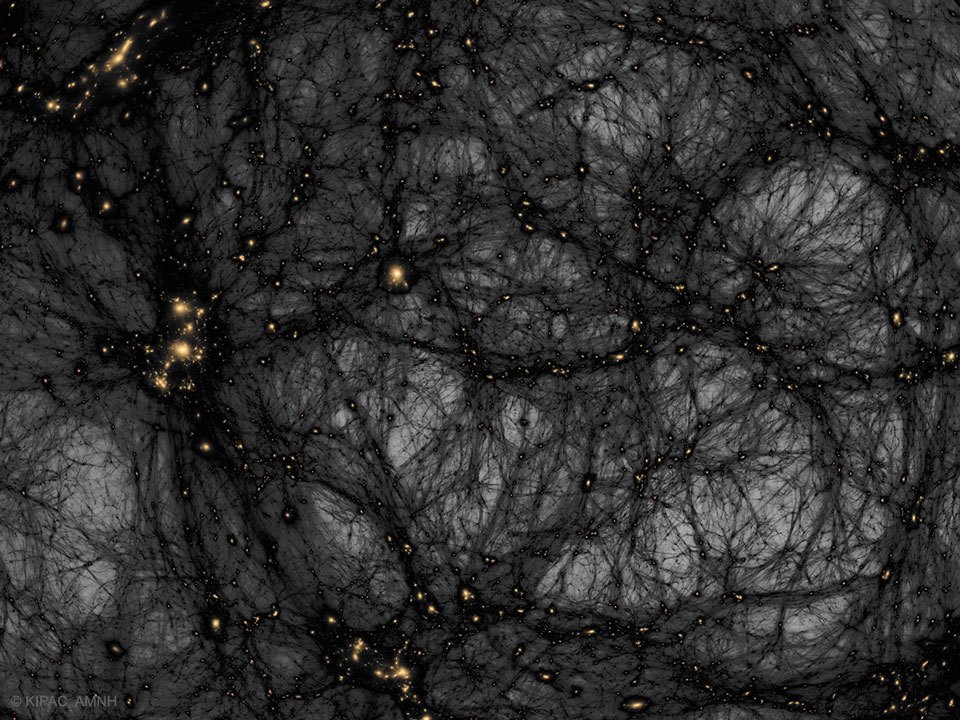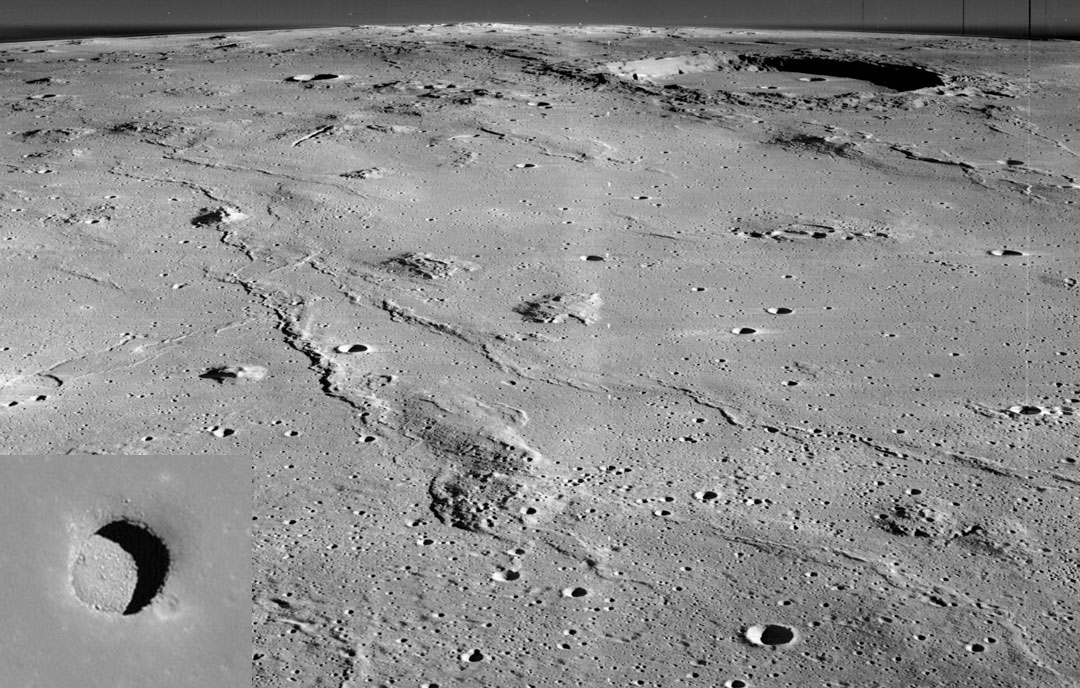Videocredit: NASA, Besatzung Expedition 36
Beschreibung: Wie wäscht man sich die Haare im Weltraum – ohne Gravitation? Das war lange Zeit eine Plage für raumfahrende Astronauten. Karen Nyberg, die 2013 als Flugingenieurin auf der Internationalen Raumstation (ISS) war, zeigt eine Anleitung. Die wichtigsten Komponenten sind eine Wasserquetschpackung, Shampoo, das nicht ausgewaschen wird, und beherzte Verwendung von Handtuch und Kamm.
Dieses Video zeigt auch, dass der ganze Prozess nur wenige Minuten dauern sollte. Restwasser verdunstet schließlich aus dem Haar und wird von der Klimaanlage der Raumstation eingesaugt und zu Trinkwasser gereinigt. Nach der Rückkehr nach insgesamt 180 Tagen im All arbeitete Nyberg in mehreren Funktionen für die NASA, unter anderem als Leiterin der Robotikabteilung.