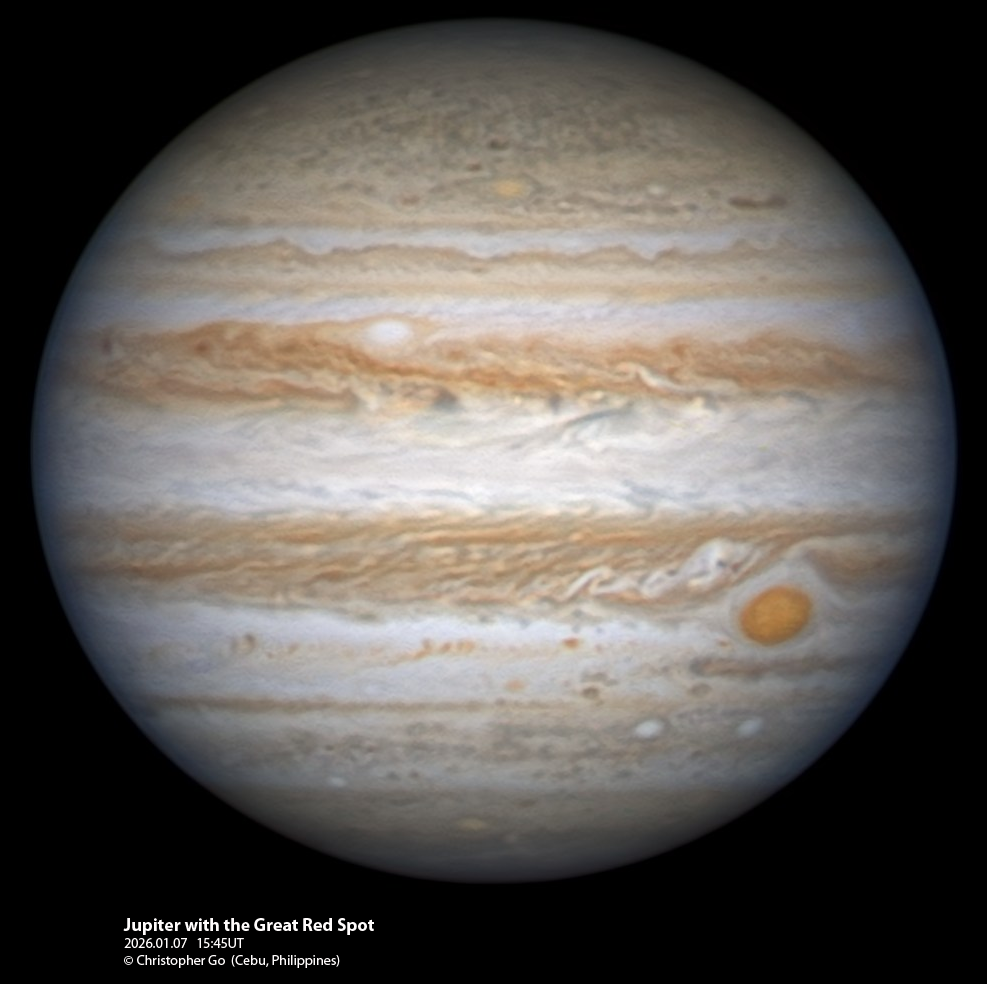Bildcredit und Bildrechte: Luigi Morrone
Der dunkle Boden des 95 Kilometer breiten Kraters Plato und die sonnenbeschienenen Gipfel der Alpen des Mondes glänzen in diesem scharfen teleskopischen Schnappschuss der Mondoberfläche. Die Alpen der Erde erhoben sich über Millionen von Jahren, während die Kontinentalplatten langsam zusammenstoßen. Doch die Alpen des Mondes bildeten sich plötzlich. Es war die Kollision, bei der auch die riesige Tiefebene des Mare Imbrium, das Meer des Regens, entstanden ist. Der flache Boden dieses Meeres ist unterhalb des Gebirgszuges zu sehen. Die auffällige gerade Struktur, die sich durch die Berge zieht, ist das Alpental Vallis Alpes. Es verbindet das Mare Imbrium mit dem nördlichen Mare Frigoris, dem Meer der Kälte. Das Tal ist etwa 160 Kilometer lang und bis zu 10 Kilometer breit. Der große, helle Berg rechts unterhalb des Kraters Plato heißt Mont Blanc. Ohne Atmosphäre und deshalb auch ohne Schnee sind die Mondalpen allerdings kein idealer Ort für den Winterurlaub. Dennoch würde eine 75 Kilo schwere Schifahrerin auf dem Mond nur etwa 12 Kilogramm wiegen.