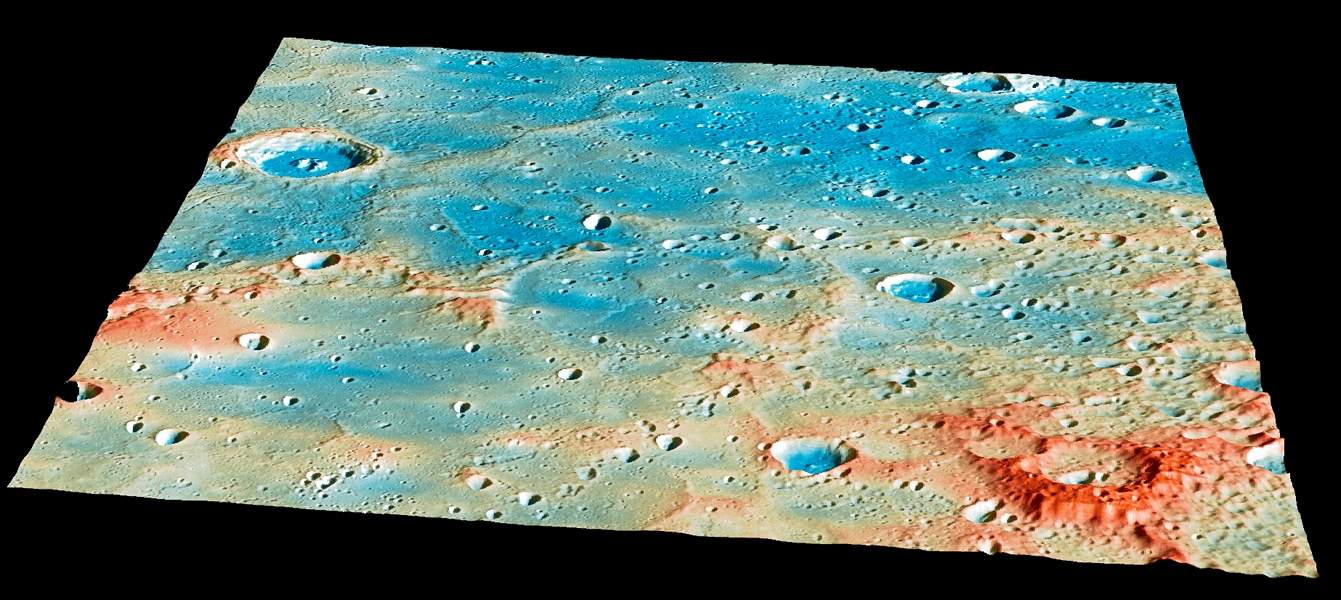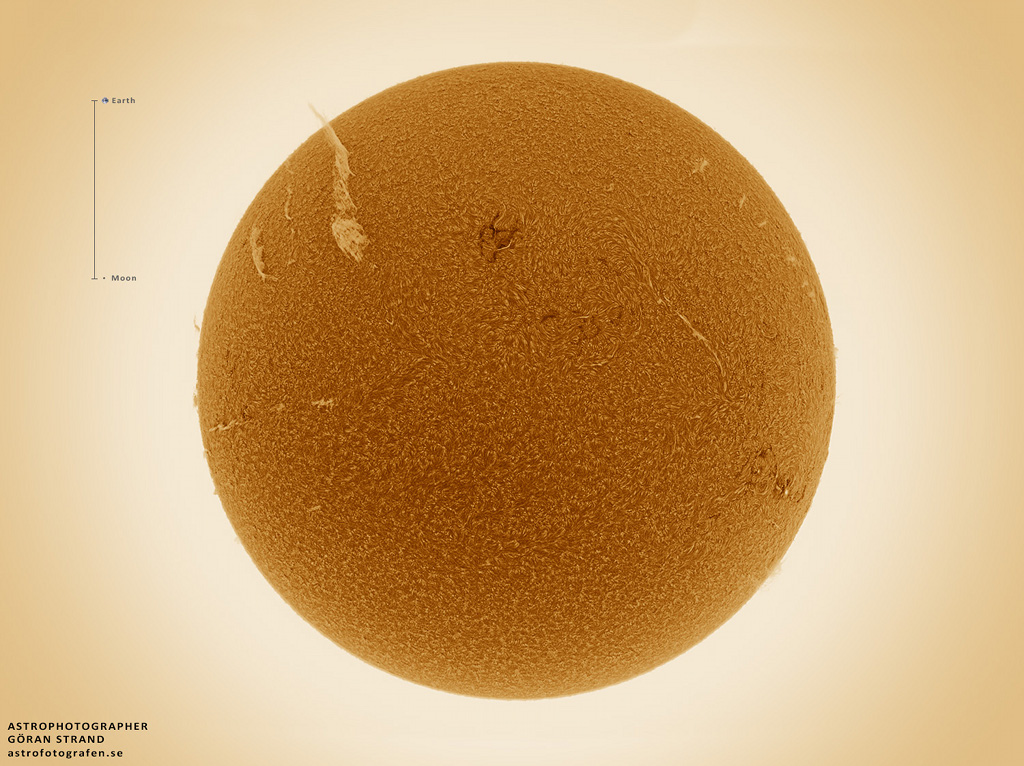Bildcredit und Bildrechte: Tommy Richardsen
Manchmal erhellt sich der Himmel unerwartet. Eine Reise am 8. Februar 2014 in den Norden Norwegens, um Polarlichter zu fotografieren, verlief nicht so gut wie erhofft. In Steinsvik in der Provinz Troms im Norden Norwegens war Mitternacht schon vorbei. In jüngster Zeit gab es Sonnenaktivität. Trotz war der Himmel enttäuschend. Also begann der Astrofotograf zu packen und wollte gehen.
Sein Bruder suchte nach einem fehlenden Objektivdeckel, als am Himmel plötzlich tolle Polarlichter explodierten. Der Fotograf reagierte schnell. Er fotografierte eine Serie detailreicher grüner Schleier. In der Mitte stand der helle Mond. Rechts suchte der Bruder den Objektivdeckel. Der Polarlichtblitz dauerte nur ein paar Minuten. Doch die Erinnerung daran bleibt vermutlich viel länger bestehen.