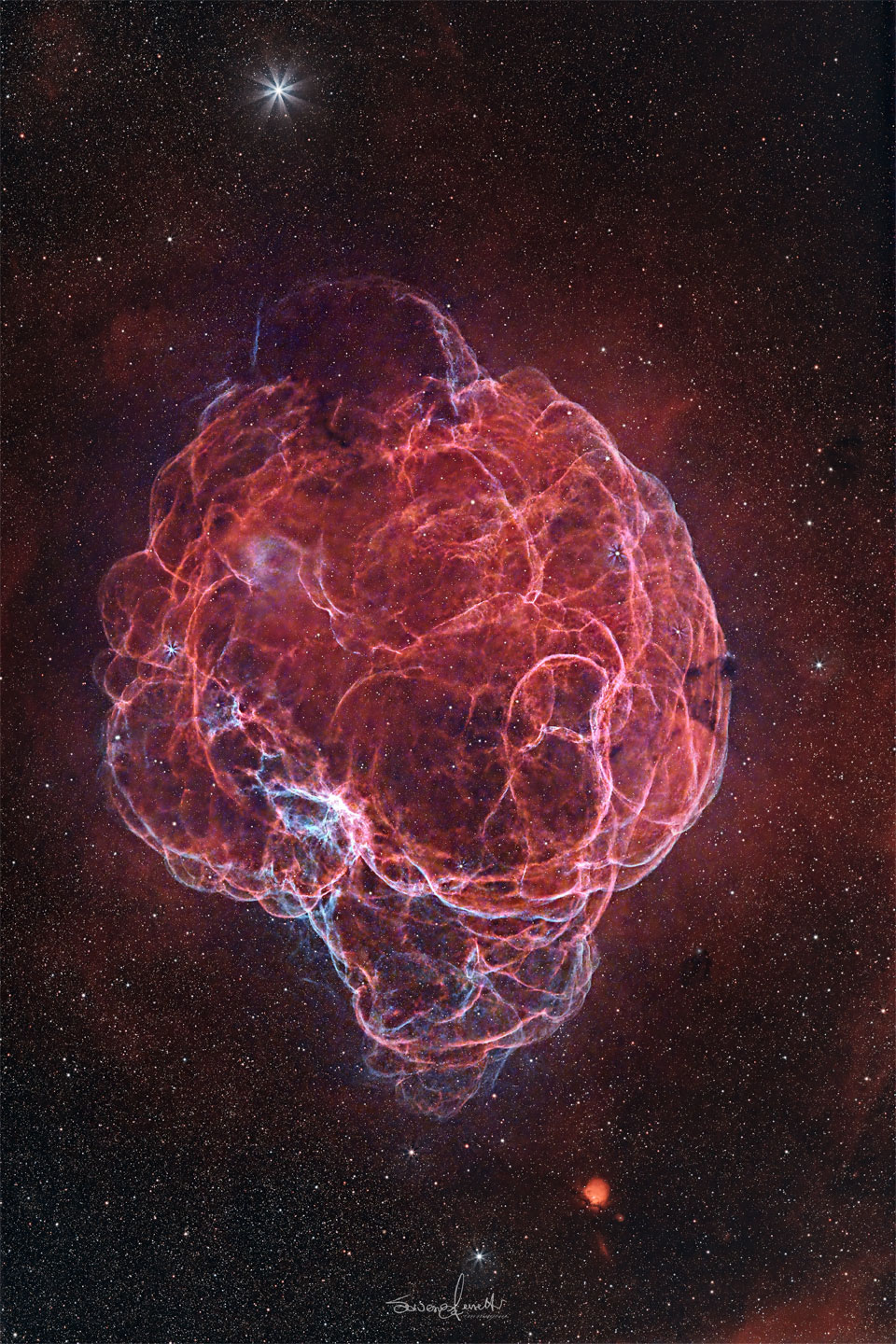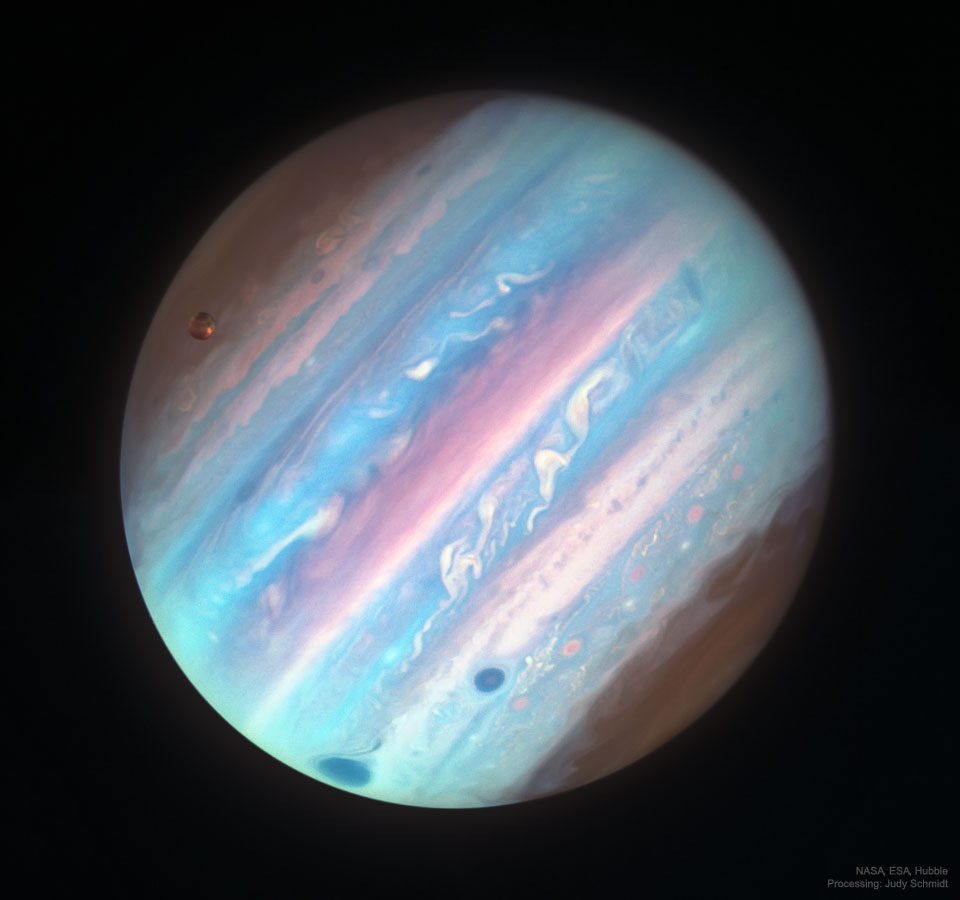Videocredit: NASA, SDO, AIA, Helioviewer; Bearbeitung und Text: Ogetay Kayali (MTU)
Was steigt da gerade von der Sonne auf? Eine hoch aufragende Struktur aus Sonnenplasma erhebt sich plötzlich von der Sonnenoberfläche und entfaltet sich im Weltraum. So groß wie mehrere Erden. Dies markiert den Beginn eines dramatischen koronalen Massenauswurfs (CME= coronal mass ejection). Das Ereignis wurde Ende 2024 vom Solar Dynamics Observatory (SDO) der NASA in beeindruckenden Details festgehalten.
Die Vorhersagen für das Weltraumwetter können durch die kontinuierliche Überwachung der Sonne verbessert werden . Es hilft der Menschheit, besser zu verstehen, wie Sonnenaktivitäten Satelliten, GPS, Funkkommunikation und Stromnetze auf der Erde beeinflussen.
Dieses Video setzt sich aus drei Aufnahmen im extremen Ultraviolett zusammen. Die Bilder kommen vom SDO-Instrument namens Atmospheric Imaging Assembly (AIA). Sie zeigen, wie Plasma mit verschiedenen Temperaturen bei dem Ausbruch nach oben geschleudert wird.
Im Video bedeutet Rot: kühleres und dichteres Material, das aus der unteren Atmosphäre der Sonne aufsteigt. Gelb zeigt extrem heiße Schleifen – sie sind Millionen Grad heiß. Diese Schleifen dehnen sich nach außen aus, weil sich die Magnetfelder der Sonne öffnen. Nach dem Hauptausbruch leuchtet es blau in der Nähe der Ausbruchsregion. Dies ist ein Zeichen für extrem erhitztes Plasma. Es blieb zurück, als sich die Magnetfelder der Sonne schnell neu ordneten.