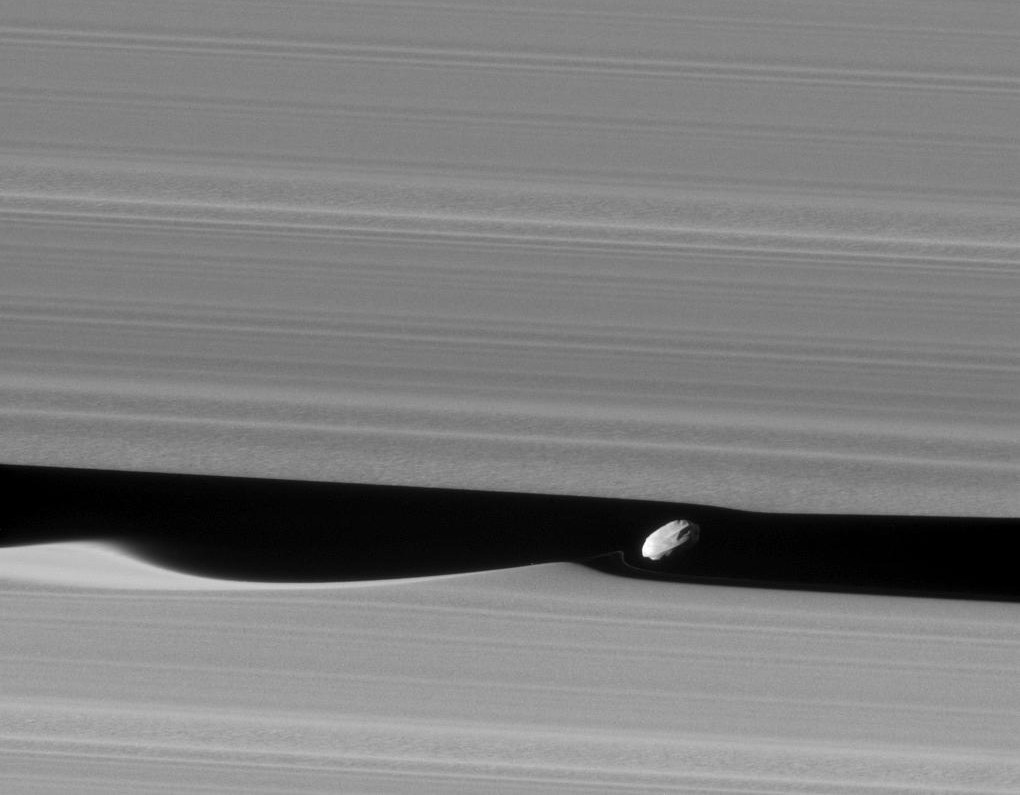Bildcredit und Bildrechte: Jeff Dai (TWAN)
Wenn man Orion sucht, findet man vielleicht auch das Wintersechseck. Dazu gehören einige der hellsten Sterne. Sie bilden auf der Nordhalbkugel der Erde ein großes, leicht erkennbares Muster am Winterhimmel. Die Sterne des Sechsecks sind oft sogar am hellen Nachthimmel einer großen Stadt erkennbar. Hier leuchteten sie am dunklen Himmel über dem Manla-Reservoir in Tibet.
Die sechs Sterne im Wintersechseck sind Aldebaran, Kapella, Kastor (und Pollux), Prokyon, Rigel und Sirius. Das Band der Milchstraße läuft mitten durch das Wintersechseck. Der offene Sternhaufen der Plejaden ist gleich darüber. Der Asterismus des Wintersechsecks umschließt mehrere Sternbilder. Dazu gehört ein großer Teil des kultigen Sternbilds Orion.