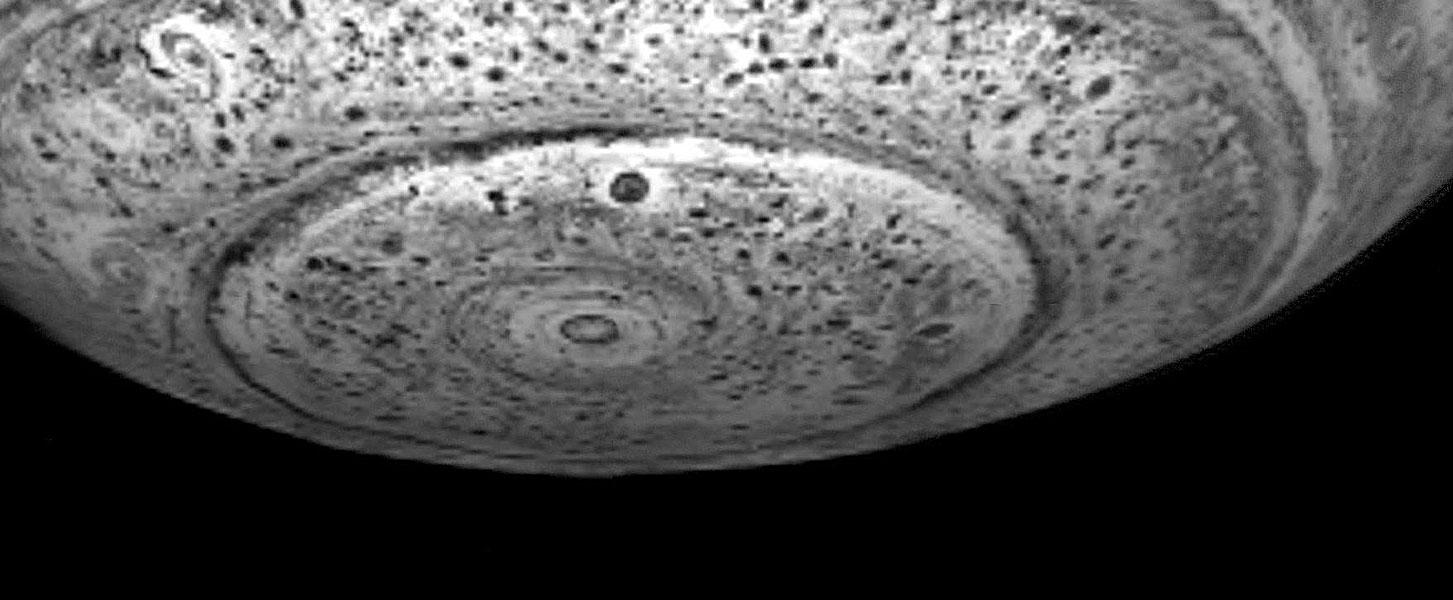Credit und Bildrechte: Star Shadows Remote Observatory (Steve Mazlin, Jack Harvey, Rick Gilbert, Teri Smoot, Daniel Verschatse)
Beschreibung: Diese furchterregende Fratze leuchtet im Dunkeln im Sternenlicht. Das krumme Profil lässt an seinen gängigen Namen denken: Hexenkopfnebel. Dieses bezaubernde Teleskop-Porträt vermittelt den Eindruck, als fixierte die Hexe ihren Blick auf Orions hellen Superriesensterm Rigel. Die kosmische Staubwolke erstreckt sich über 50 Lichtjahre und reflektiert das blaue Licht des nahe gelegenen Sterns Rigel, was ihr die charakteristische Farbe eines Reflexionsnebels verleiht. Der Hexenkopfnebel ist als IC 2118 katalogisiert und etwa 1000 Lichtjahre entfernt. Natürlich könnten Sie in der heutigen Gruselnacht eine Hexe sehen, aber keine Panik! Wir wünschen einen sicheren und fröhlichen Abend vor Allerheiligen!