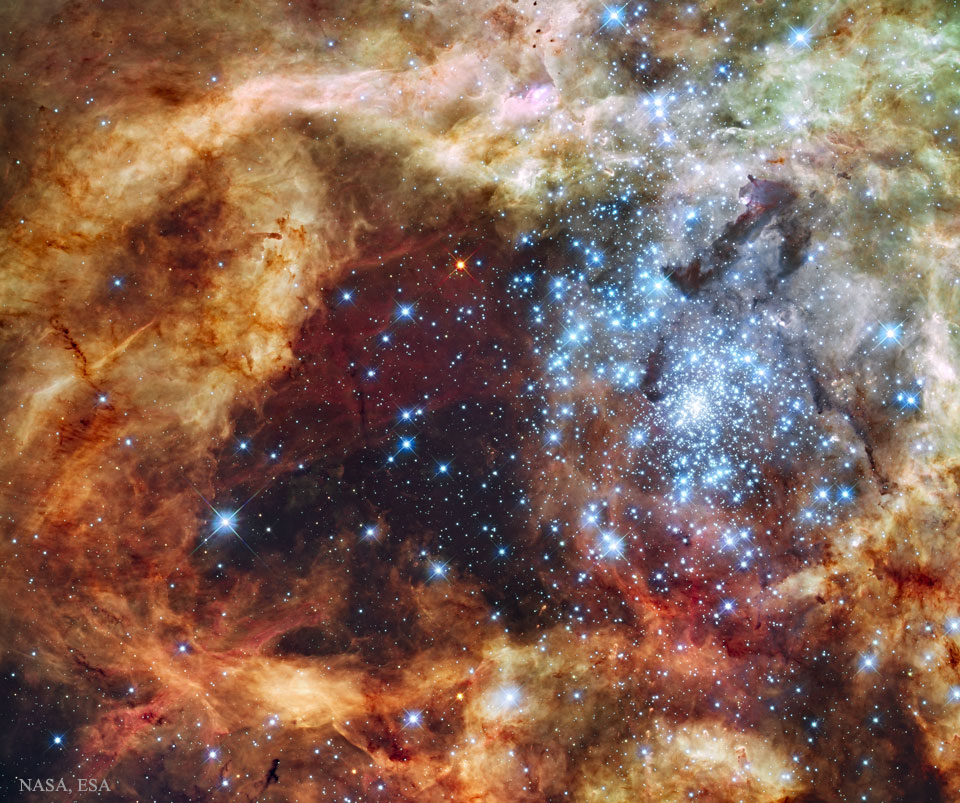Bildcredit und Bildrechte: Petr Horalek / Institut für Physik in Opava
Beschreibung: Heute Abend könnt ihr den Mars am Abendhimmel sehen. Dort ist derzeit der Rover Perseverance stationiert. Der Rote Planet wandert am Himmel derzeit durch das Sternbild Stier und zieht nahe am Sternhaufen der Plejaden vorbei, benannt nach den sieben Schwestern.
Diese detailreiche Weitwinkelansicht der Region zeigt Mars am 3. März bei seiner fast engsten Annäherung an die Plejaden. Mars ist das helle, gelbliche Himmelslicht unten in der Mitte, er ist nur etwa 3 Grad vom hübschen blauen Sternhaufen entfernt.
Aldebaran, der Alphastern im Stier, wetteifert in Farbe und Helligkeit mit dem Mars. Der rote Riesenstern befindet sich links unten, er ist ein Vordergrundstern in der Sichtlinie zum weiter entfernten Sternhaufen der Hyaden. Die dunklen, staubigen Nebel sind für das bloße Auge zu blass, sie liegen am Rand der massereichen Perseus-Molekülwolke. Rechts oben seht ihr das markante rötliche Leuchten von NGC 1499, dem Kaliforniennebel.
Umfrage zu Ästhetik und Astronomie (englisch): Vertonungen
Zur Originalseite