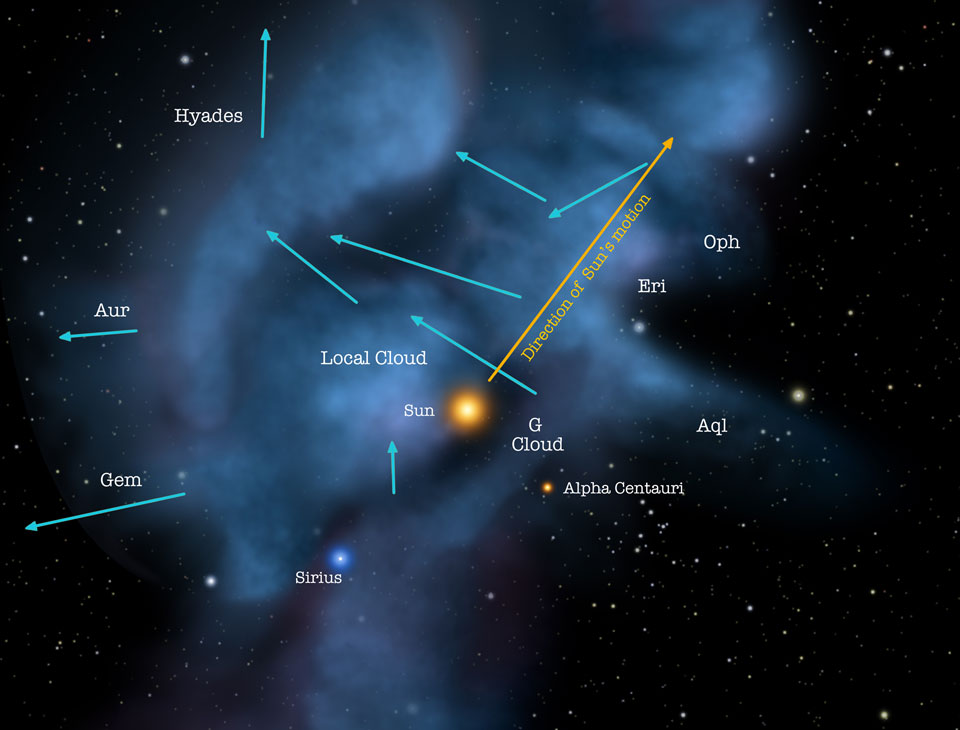Bildcredit: NASA, ESA, CSA, STScI, JWST; Bearbeitung: Alyssa Pagan (STScI); Überlagertes Bild: NASA, ESA, HST und J. M. Apellániz (IAA, Spain); Danksagung: D. De Martin (ESA/Hubble)
Wie massereich kann ein normaler Stern sein? Aufgrund der Entfernung, Helligkeit und sogenannten Standard-Sonnenmodellen wurde die Masse eines Sterns im offenen Sternhaufen Pismis 24 geschätzt. Seine Masse entspricht der 200-fachen Sonnenmasse. Das macht ihn zu einem der massereichsten Sterne, die man kennt.
Dieser Stern ist das hellste Objekt in der oberen Bildhälfte. Er ist auch als Pismis 24-1 bekannt. Das Foto wurde mit dem James-Webb-Weltraumteleskop im infraroten Licht aufgenommen. Zum Vergleich ist ein Bild darüber gelegt, das vom Hubble-Weltraumteleskop im sichtbaren Licht aufgenommen wurde.
Bei genauerer Untersuchung der Bilder stellte sich heraus, dass Pismis 24-1 seine brillante Leuchtkraft nicht nur einem, sondern mindestens drei Sternen verdankt. Die einzelnen Sterne haben immer noch eine Masse von rund 100 Sonnenmassen. Damit gehören auch sie zu den massereichsten Sternen, die wir kennen.
Am unteren Bildrand befindet sich der dazugehörige Emissionsnebel NGC 6357. Dort bilden sich nach wie vor weitere Sterne. Es scheint, als würden die energiereichen Sterne nahe dem Zentrum aus ihrem spektakulärem Kokon herausbrechen und ihn beleuchten. Der himmlische Anblick erinnert stark an eine gotische Kathedrale.