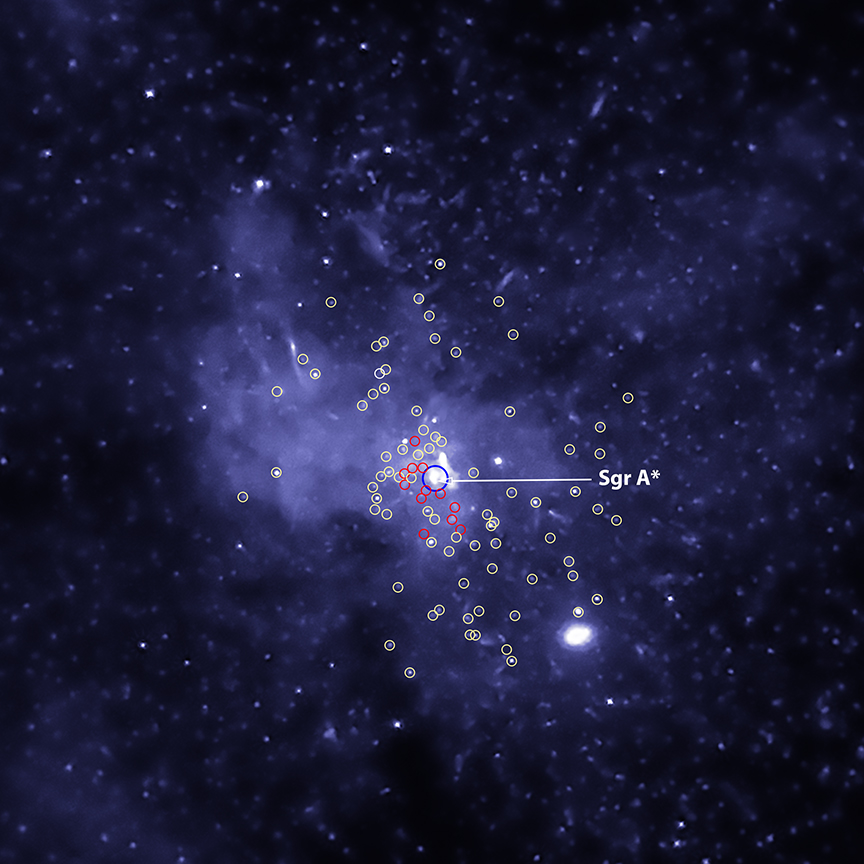Bildcredit und Lizenz: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors)
Hier seht ihr eine der fotogensten Regionen am Nachthimmel. Sie wurde hier eindrucksvoll abgebildet. Ganz links verläuft diagonal das Band unserer Milchstraße. Rechts neben der Mitte seht ihr die farbenprächtige Rho-Ophiuchi-Region mit dem hellen orangefarbenen Stern Antares. Der Nebel Sharpless 1 (Sh2-1) befindet sich ganz rechts. Vor dem Band der Milchstraße liegen mehrere berühmte Nebel. Dazu gehören der Adlernebel (M16), der Trifidnebel (M21) und der Lagunennebel (M8). Weitere namhafte Nebel sind die Pfeife und der blaue Pferdekopf.
Allgemein stammt Rot von Nebeln, in denen das Licht von angeregtem Wasserstoff stammt. Blau markiert interstellaren Staub, der bevorzugt das Licht heller junger Sterne reflektiert. Dichter Staub erscheint dunkelbraun, wenn er nicht beleuchtet wird. Auch große Sternkugeln sind zu sehen. Dazu gehören die Kugelsternhaufen M4, M9, M19, M28 und M80. Jeder davon ist auf dem beschrifteten Begleitbild markiert.
Dieses sehr breite Feld misst etwa 50 Grad. Es umfasst die Sternbilder Schütze links unten, Schlange links oben, Schlangenträger in der Mitte und rechts den Skorpion. Um dieses Bild zu erstellen, brauchte es mehr als 100 Stunden Himmelsfotografie, kombiniert mit minutiöser Planung und digitaler Bildbearbeitung.