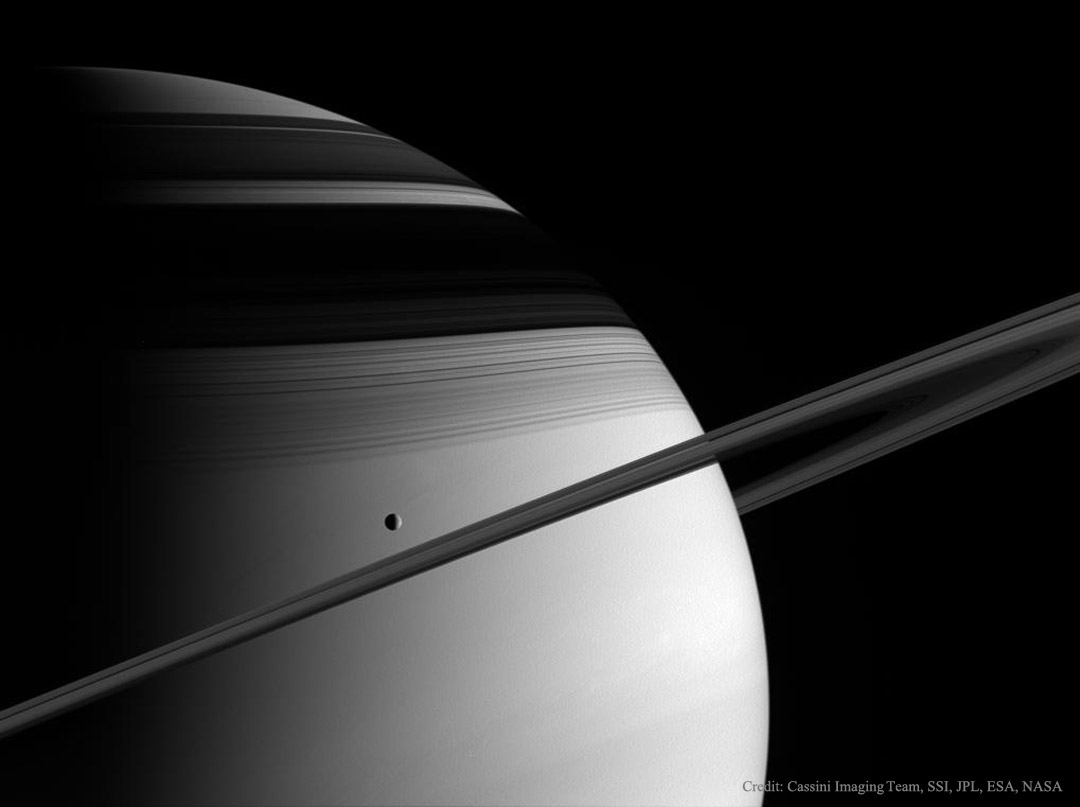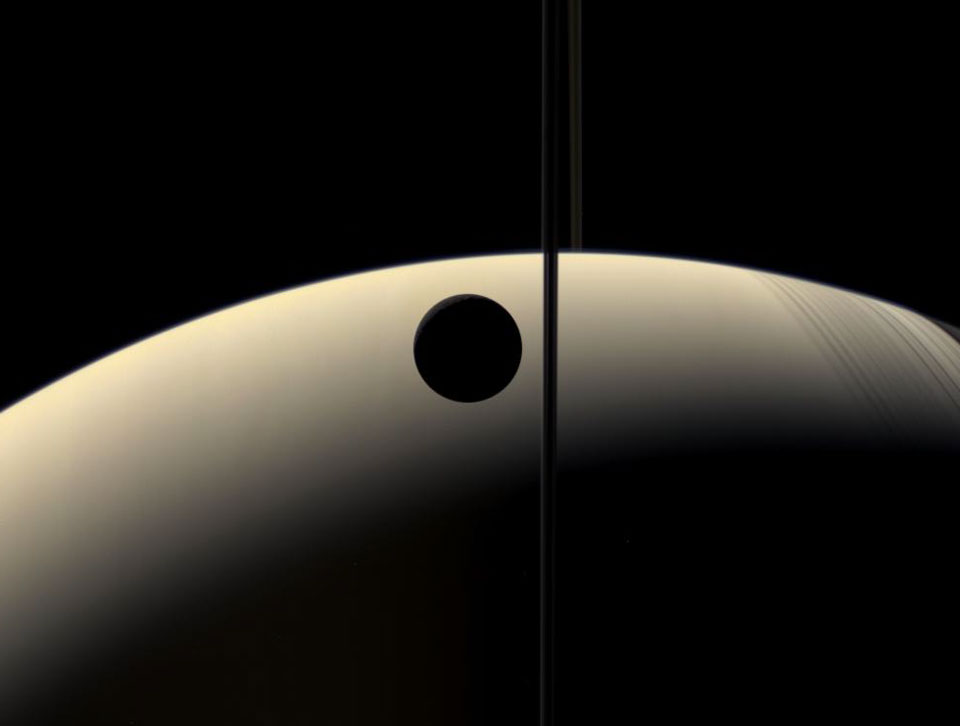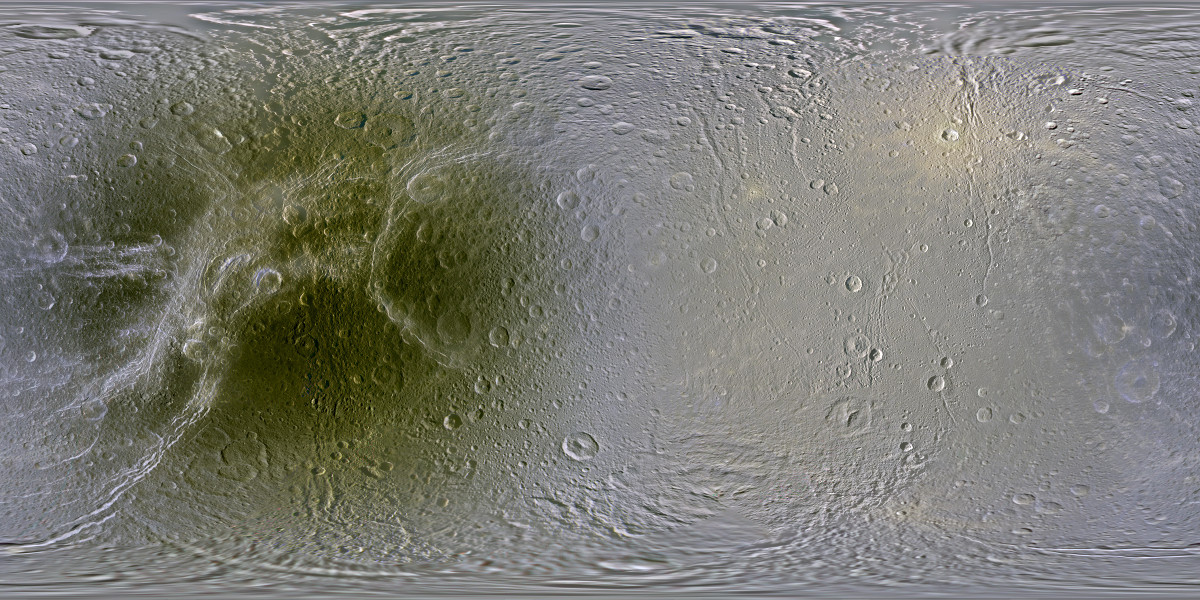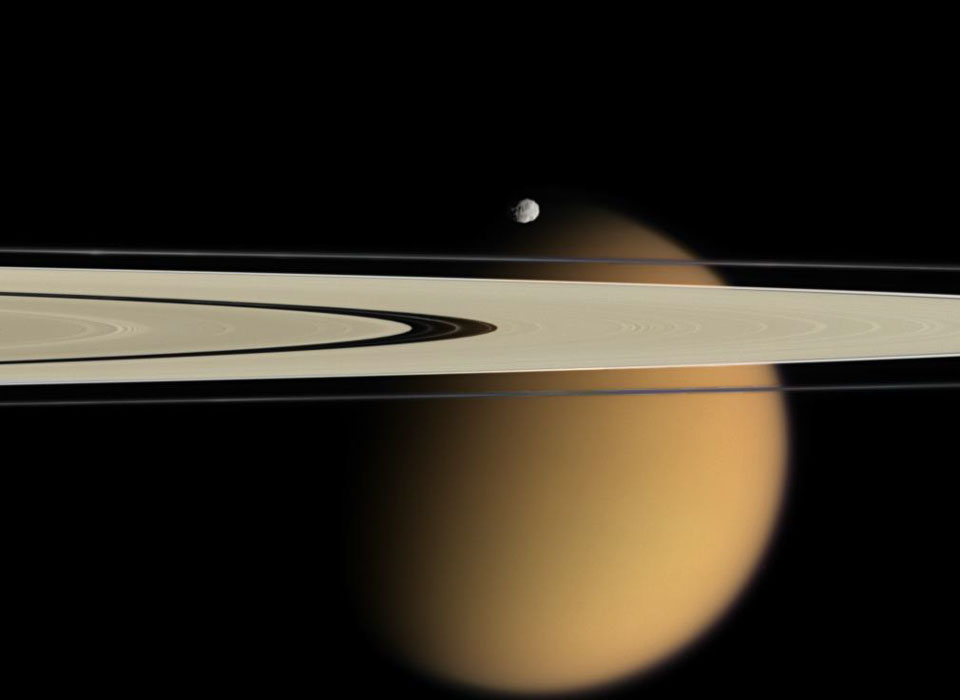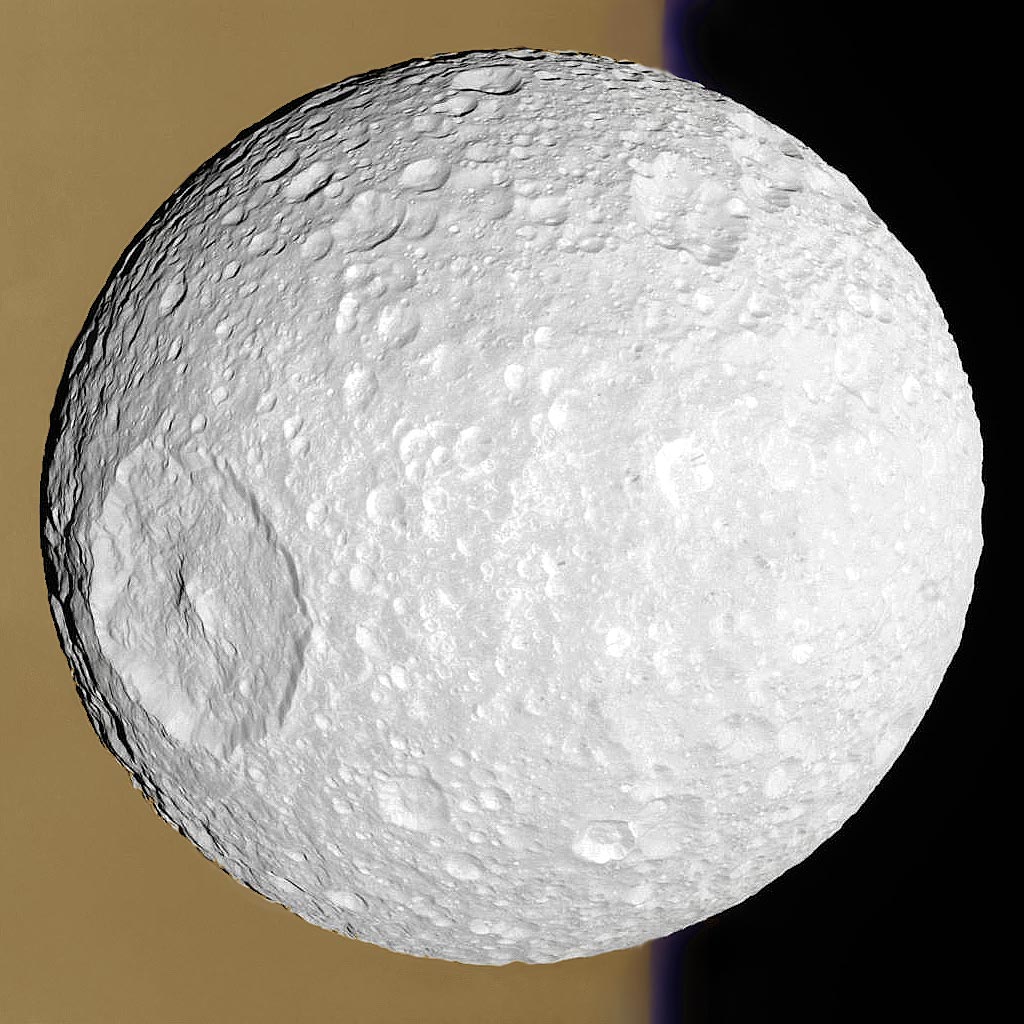Bildcredit und Bildrechte: Marko Korosec
Die Lyriden gehören zu den Meteorströmen im April. Seit mehr als 2000 Jahren werden sie jährlich beobachtet. Dann durchquert die Erde den Staubstrom, den der langperiodische Komet Thatcher zurücklässt.
Diese Ansicht des Nachthimmels entstand am 21. April in den Morgenstunden. Sie zeigt ein aufgefegtes Staubkörnchen des Kometen, das mit 48 km/s in einer Höhe von zirka 100 Kilometern dahinraste. Der gleißende Streifen des Meteors blitzt am südöstlichen Horizont auf. Er kreuzt die zentrale Milchstraße, die gerade aufgeht.
Seine Bahn zeigt rückwärts zum Radianten des Stroms im Sternbild Leier (Lyra). Es steht hoch am nördlichen Frühlingshimmel, das nicht im Bild liegt. Der gelbliche Riesenstern Antares leuchtet rechts neben der Wölbung der Milchstraße. Noch höher steht rechts der helle Planet Saturn. Der Lyrid leuchtet grünlich über der kroatischen Halbinsel Istrien. Er spiegelt sich im Wasser der Adria.