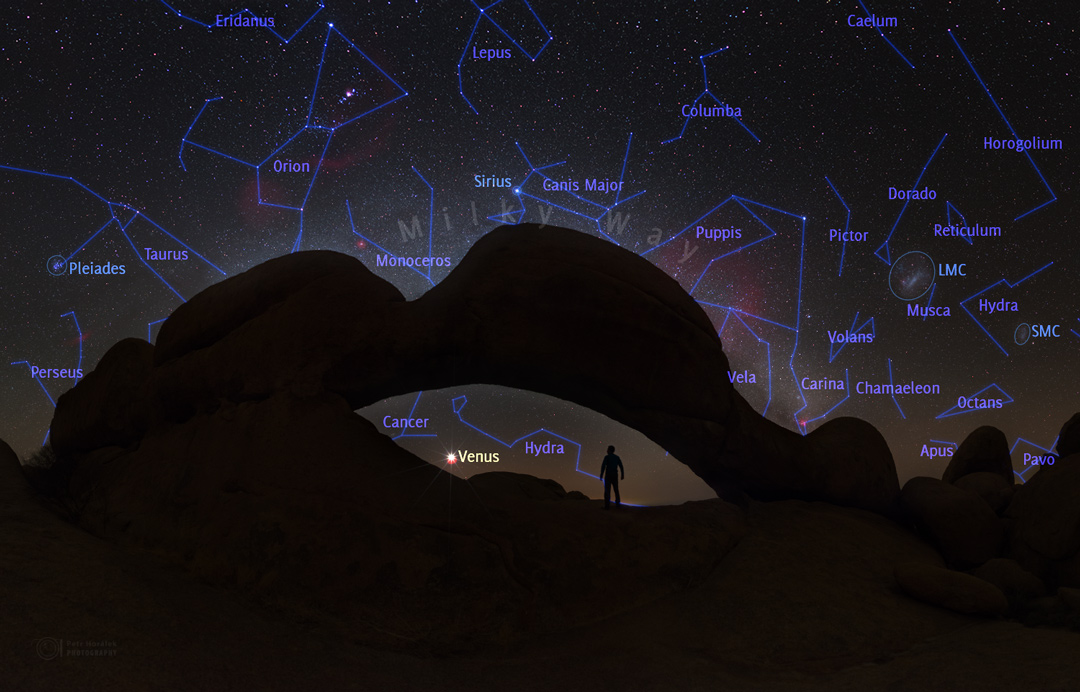Bildcredit und Bildrechte: Terry Hancock (Down Under Observatory)
Den großen Nebel im Orion kennt man auch als M42. Er ist einer der berühmtesten Nebel am Himmel. Die leuchtenden Gaswolken und die heißen jungen Sterne in der Sternbildungsregion befinden sich im scharfen, bunten Bild rechts. Links schimmert der bläuliche Reflexionsnebel NGC 1977 mit seinen Freunden.
Die markanten Nebel liegen am Rand eines meist unsichtbaren gewaltigen Komplexes aus Molekülwolken. Sie zeigen nur einen kleinen Teil vom Reichtum an interstellarer Materie in unserer galaktischen Nachbarschaft. Im gut erforschten Sternbildungsgebiet fanden Astronominnen* viele Objekte, die anscheinend junge Planetensysteme sind. Man bezeichnet sie als Proplyden.
Die prächtige Himmelslandschaft ist fast zwei Grad breit. Da der Orionnebel etwa 1500 Lichtjahre entfernt ist, entspricht das einer Breite von ungefähr 45 Lichtjahren.