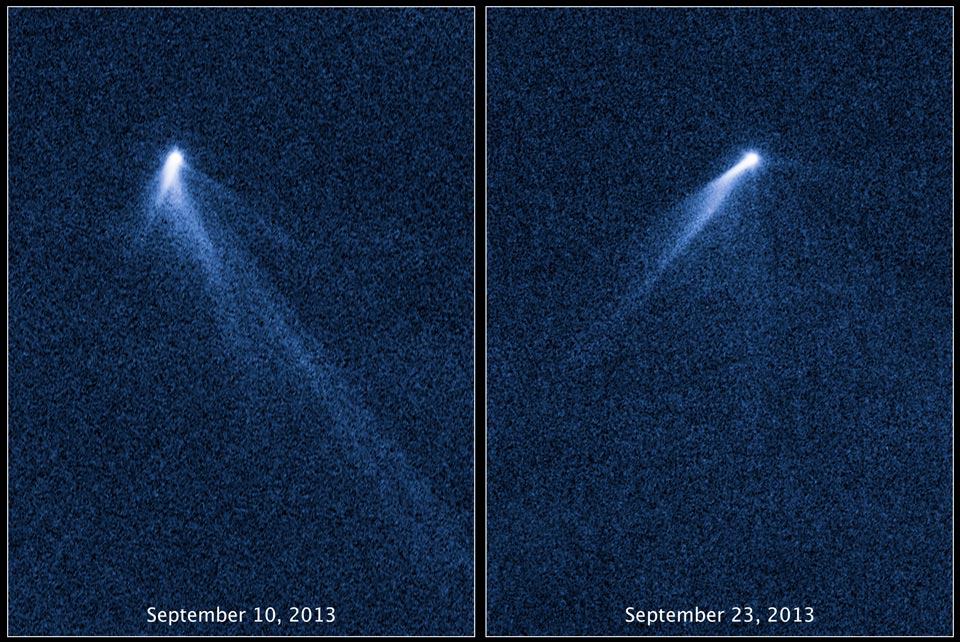Bilddaten: Subaru-Teleskop (NAOJ), Weltraumteleskop Hubble; zusätzliche Farbdaten und Bearbeitung: Robert Gendler
Der Orionnebel ist eine große Sternbildungsregion. Südlich davon liegt der helle, blaue Reflexionsnebel NGC 1999. Er liegt am Rand der komplexen Orion-Molekülwolke, die etwa 1500 Lichtjahre entfernt ist. NGC 1999 wird vom eingebetteten Stern V380 Orionis beleuchtet. In den Nebel ist eine seitlich geneigte T-Form mitten in dieser kosmischen Aussicht gekerbt. Sie ist etwa 10 Lichtjahre groß.
Die dunkle Form galt früher als undurchsichtige Staubwolke, die als Silhouette vor dem hellen Reflexionsnebel liegt. Doch aktuelle Infrarotbilder zeigen, dass sie wahrscheinlich ein Loch ist. Es wurde von jungen, energiereichen Sternen im Nebel ausgehöhlt.
In der Region befinden sich tatsächlich viele energiereiche junge Sterne. Ihre Strahlen und Ausflüsse erzeugen leuchtende Stoßwellen. Die Bugwellen sind als Herbig-Haro-Objekte (HH-Objekte) katalogisiert. Benannt wurden sie nach den Astronomen George Herbig und Guillermo Haro.
Die Objekte HH1 und HH2 befinden sich in dieser Szenerie unter NGC 1999. Sie sehen wie rote Kerben aus. Die Sternströme stoßen mit einer Geschwindigkeit von Hunderten Kilometern pro Sekunde auf die umgebende Materie.