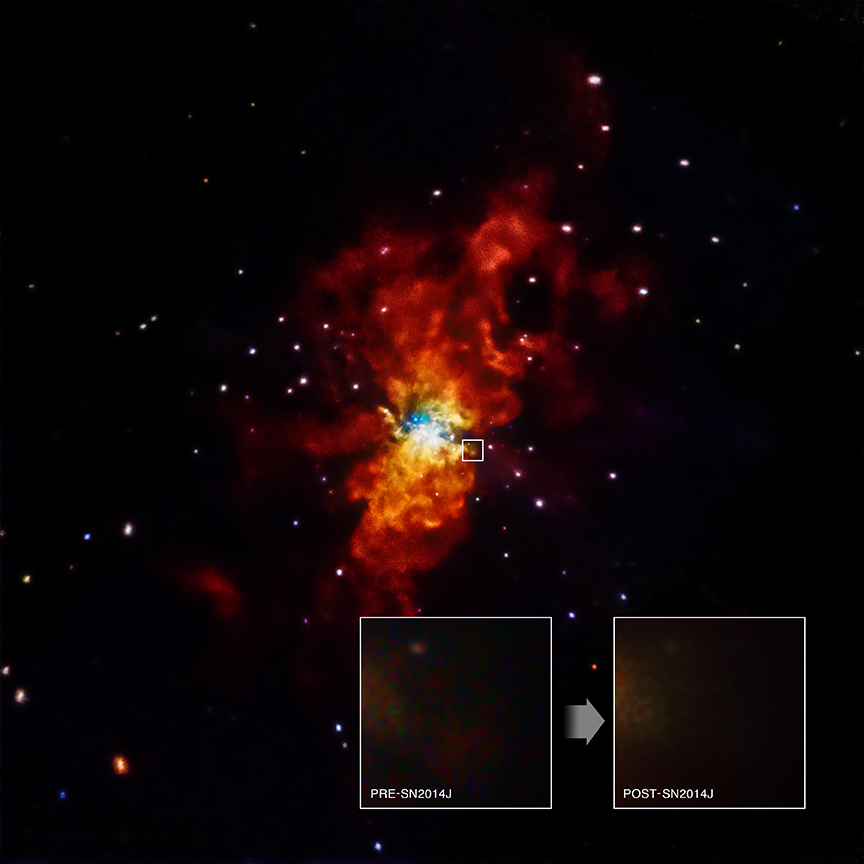Bildcredit und Bildrechte: P-M Hedén (Clear Skies, TWAN)
In der Nacht von 17. auf 18. März entfaltete sich dieser Schirm aus Nordlicht über Gärten im schwedischen Vallentuna. Der Ort liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Stockholm.
Die Polarlichter entstanden durch den stärksten geomagnetischen Sturm in diesem Sonnenzyklus. Sie wurden in dieser Nacht sogar in niedrigeren geografischen Breiten in dunklen Hinterhöfen und Vorgärten fotografiert. Es gab Sichtungen im Mittleren Westen der USA.
Der Teilchensturm im Weltraum war ein Segen für Leute, die Polarlichter jagen. Er entstand, als ein koronaler Massenauswurf die Magnetosphäre des Planeten Erde traf. Der koronale Massenauswurf begann etwa zwei Tage zuvor durch Sonnenaktivität.
Wie heißt wohl die Gartensternwarte rechts auf dieser Weitwinkelansicht? Natürlich Carpe-Noctem-Observatorium.