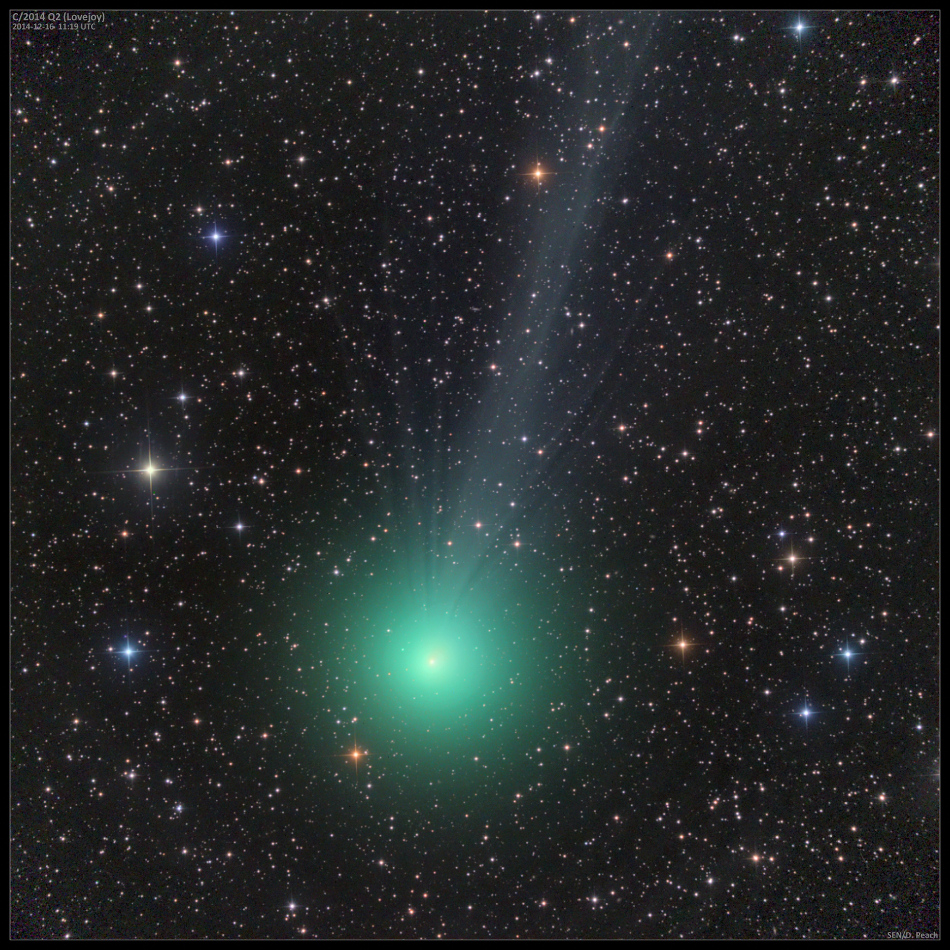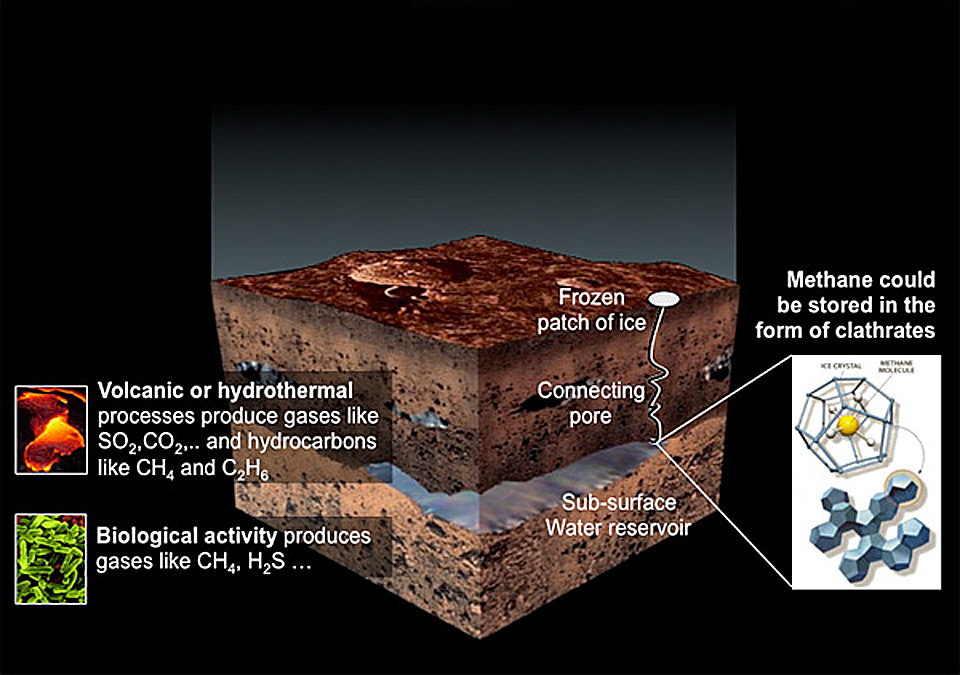Bildcredit und Bildrechte: Aigar Truhin
Was passiert über dieser Stadt? Wenn man genau schaut, zeigt sich, dass die seltsamen Lichtsäulen über hellen Lampen auftreten. Daher sind es wahrscheinlich Lichtsäulen. In diesen Säulen reflektieren fallende Eiskristalle das Licht der Lampen. Dieses Bild und mehrere ähnliche Fotos wurden Ende 2009 in Sigulda (Lettland) mit einer normalen Digitalkamera fotografiert.
Die Säulen werden oben breiter. Warum das so ist, kann man nur vermuten. Die Luft war sehr kalt und voller kleiner Eiskristalle. Solche Kristalle führen zu eindrucksvollen Himmelsphänomenen, die man gut kennt. Dazu gehören Lichtsäulen, Sonnensäulen, Nebensonnen und Mondhöfe.
An manchen Orten auf der Nordhalbkugel ist der Winter dieses Jahr sehr kalt und schneereich. So gibt es viele unerwartete Gelegenheiten, ungewöhnliche optische Erscheinungen in der Atmosphäre mit eigenen Augen zu sehen.