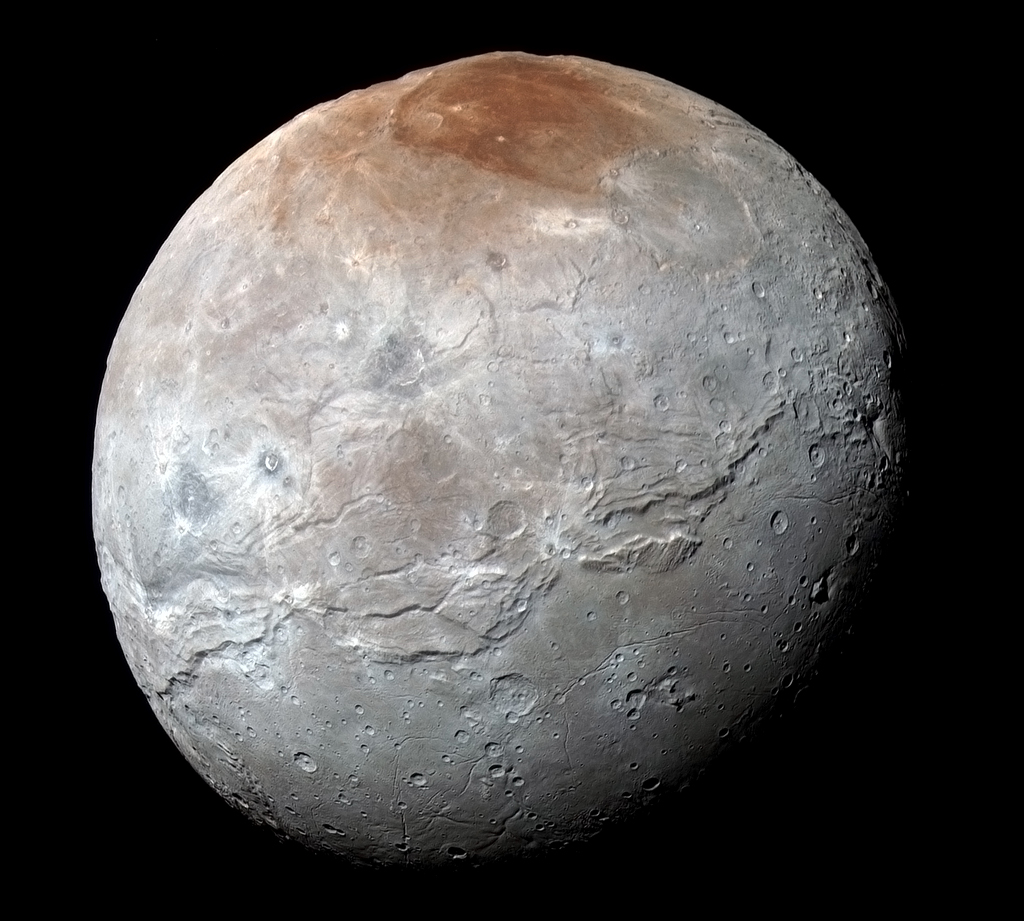Bildcredit: Subaru-Teleskop (NAOJ), Weltraumteleskop Hubble, Europäische Südsternwarte (ESO); Bearbeitung und Bildrechte: Robert Gendler
Die große, schöne Spiralgalaxie M83 ist etwa zwölf Millionen Lichtjahre entfernt. Sie liegt südöstlich im sehr langen Sternbild Wasserschlange. Die markanten Spiralarme sind von dunklen Staubbahnen gesäumt. Blaue Sternhaufen führten zu dem gängigen Namen der Galaxie: „Südliches Feuerrad“. Rötliche Regionen mit Sternbildung sprenkeln die ausladenden Arme. Auf dem funkelnden Farbkomposit wurden sie betont. Sie führten zu einem weiteren Namen: „Tausend-Rubine-Galaxie“.
M83 ist etwa 40.000 Lichtjahre groß. Sie gehört zur selben Galaxiengruppe wie die aktive Galaxie Centaurus A. Der Kern von M83 leuchtet im Röntgenlicht hell. Er besitzt eine hohe Konzentration an Neutronensternen und Schwarzen Löchern. Diese blieben nach einem heftigen Ausbruch an Sternbildung übrig.
Das scharfe, farbige Bildkomposit zeigt auch gezackte Sterne, die im Vordergrund in der Milchstraße liegen. Auch ferne Galaxien im Hintergrund sind zu sehen. Die Bilddaten stammen vom Subaru-Teleskop, von der Weitwinkelkamera WFI der Europäischen Südsternwarte (ESO) und aus dem Hubble-Vermächtnis.