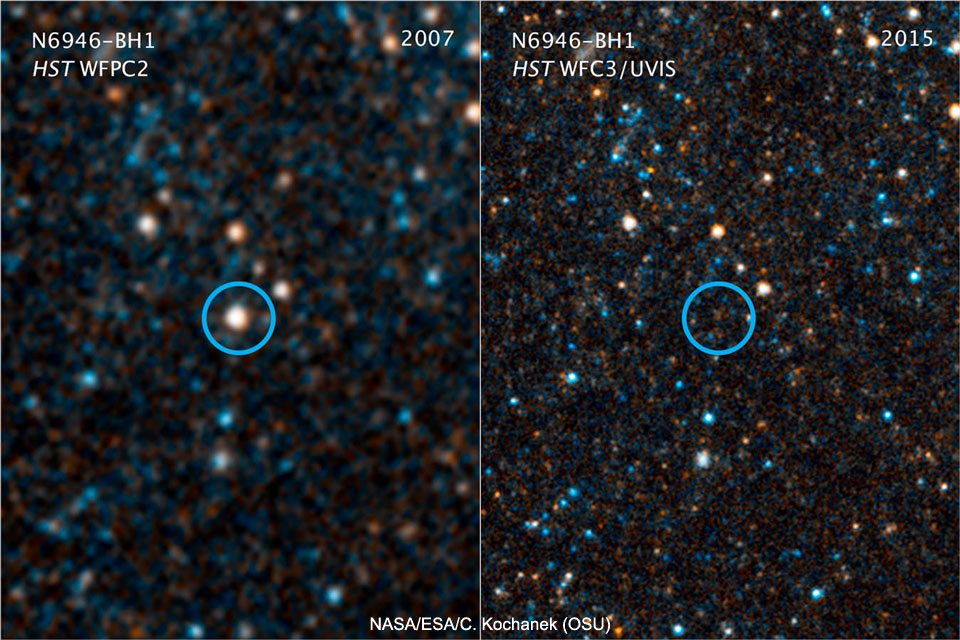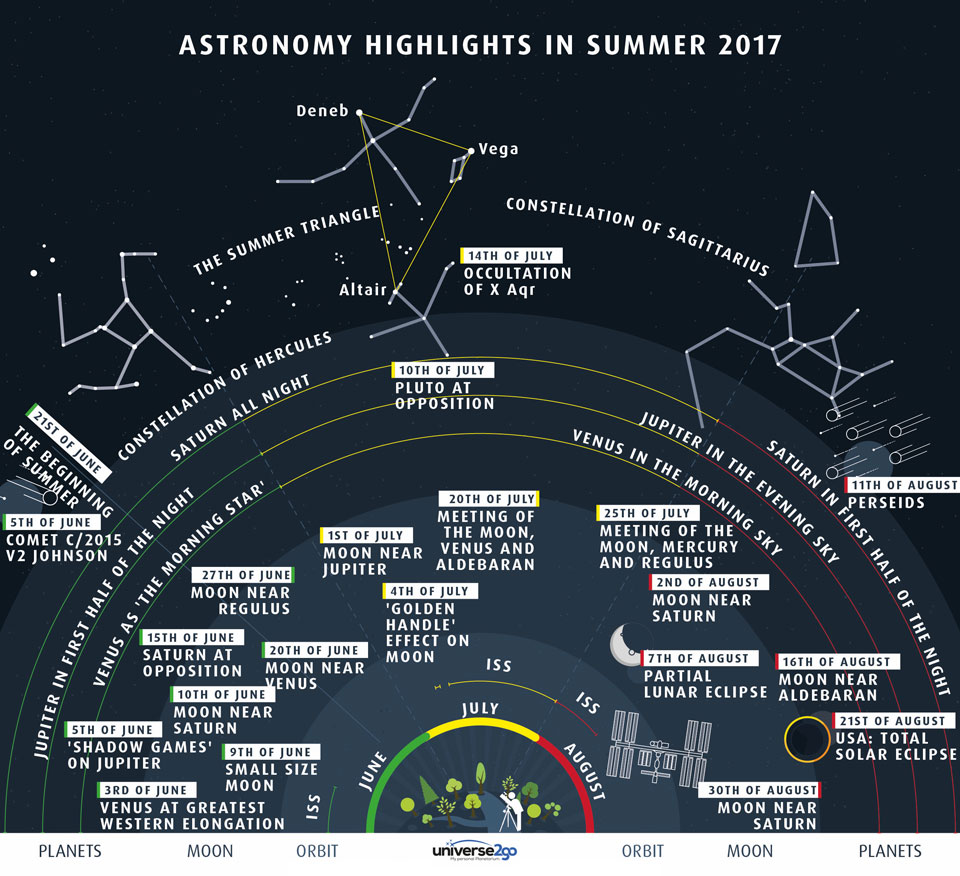Bildcredit: NASA, ESA und das Hubble-Vermächtnisteam (STScI/AURA); Danksagung: R. Sahai (JPL) et al.
IC 418 hat eine seltsame Struktur. Wie entstand sie? Sie hat eine Ähnlichkeit mit Zeichnungen, die mit einem zyklischen Zeichengerät gemacht werden, daher heißt der planetarische Nebel IC 418 Spirographnebel.
Seine Muster sind nicht nachvollziehbar. Vielleicht entstehen sie im Zusammenhang mit chaotischen Winden, die vom veränderlichen Zentralstern ausgehen. Die Helligkeit des Sterns kann sich in wenigen Stunden unberechenbar ändern. Doch es gibt Hinweise, dass IC 418 vor nur wenigen Millionen Jahren vielleicht ein gut verstandener Stern war, ähnlich wie unsere Sonne.
Vor ein paar Tausend Jahren war IC 418 vielleicht ein gewöhnlicher roter Riesenstern. Als jedoch sein Kernbrennstoff zur Neige ging, begann die äußere Hülle, sich auszudehnen, und hinterließ einen heißen Restkern. Er war dazu bestimmt, ein weißer Zwergstern zu werden. Man sieht ihn in der Bildmitte. Das Licht des zentralen Kerns regt die Atome im Nebel, die ihn umgeben, an und bringt sie zum Leuchten.
IC 418 ist ungefähr 2000 Lichtjahre entfernt und 0,3 Lichtjahre groß. Dieses Bild in Falschfarben entstand mit dem Weltraumteleskops Hubble. Es zeigt die ungewöhnlichen Details.