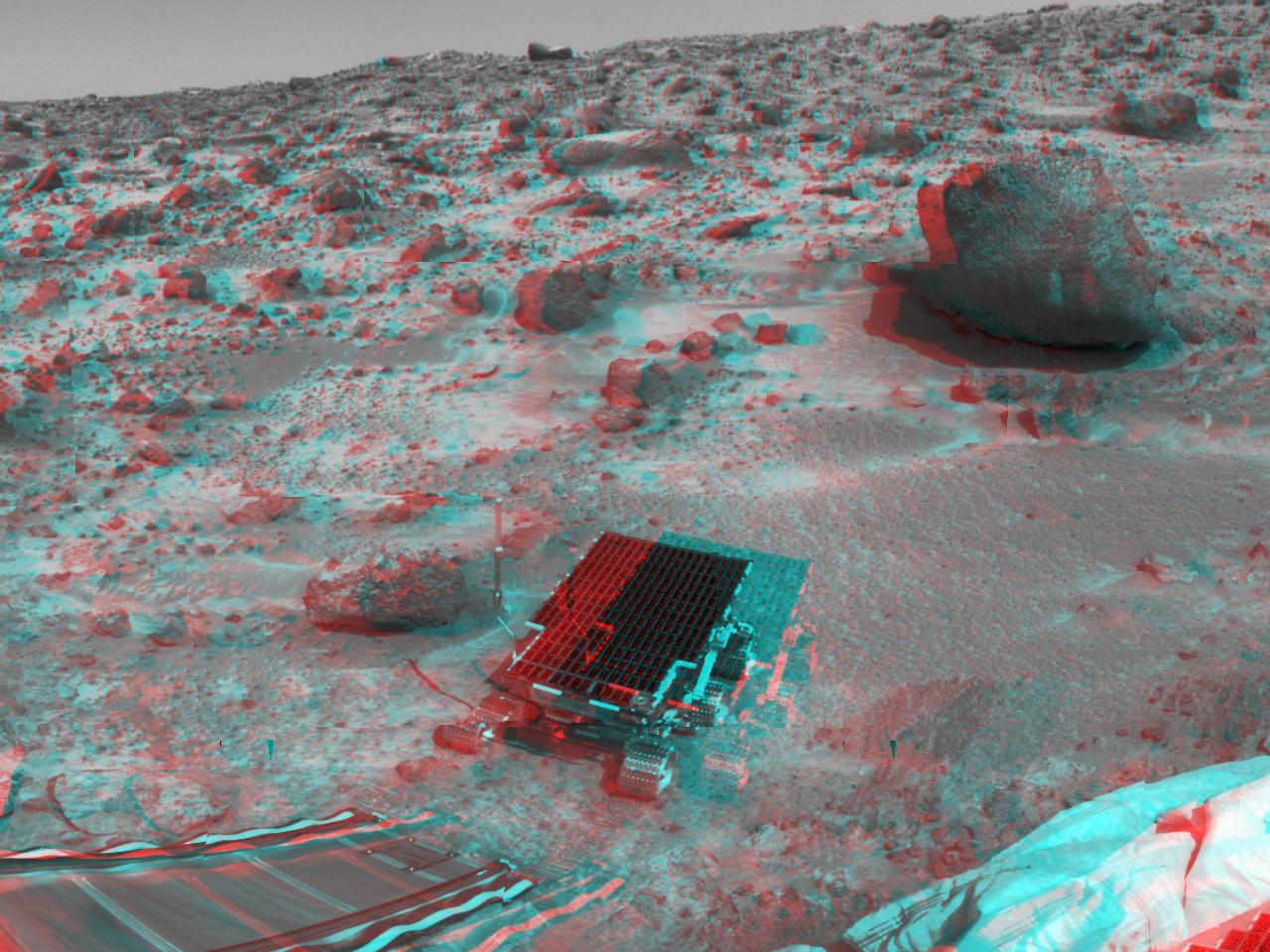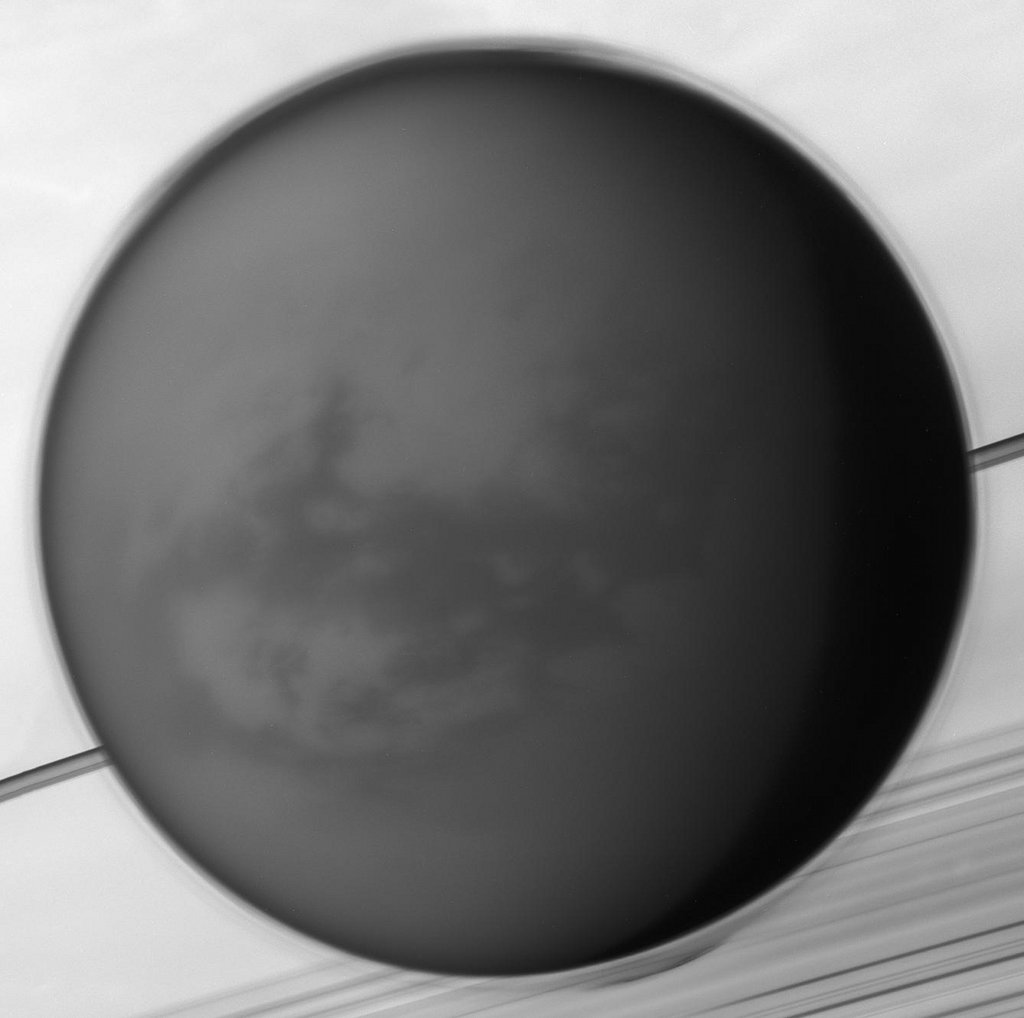Bildcredit und Bildrechte: Jason Rice
Hast du schon einmal eine Feuerkugel gesehen? In der Astronomie ist eine Feuerkugel ein sehr heller Meteor, der mindestens so hell wie die Venus und möglicherweise sogar heller als der Vollmond erscheint. Feuerkugeln sind selten. Wenn man eine sieht, erinnert man sich wahrscheinlich ein Leben lang daran.
Physikalisch gesehen ist eine Feuerkugel ein kleiner Gesteinsbrocken, der von einem Asteroiden oder Kometen stammt. Während er durch die Erdatmosphäre rast, hinterlässt er typischerweise eine Spur aus Gas und Staub, die verblasst. Es ist unwahrscheinlich, dass ein großer Einschlag am Boden stattfand, denn ein Großteil des Gesteins ist wahrscheinlich verdampft, als es in viele kleine Stücke zerbrach.
Das gezeigte Bild wurde letzte Woche an einem „Treibholzstrand“ in Cape San Blas, Florida, USA, aufgenommen.
Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages