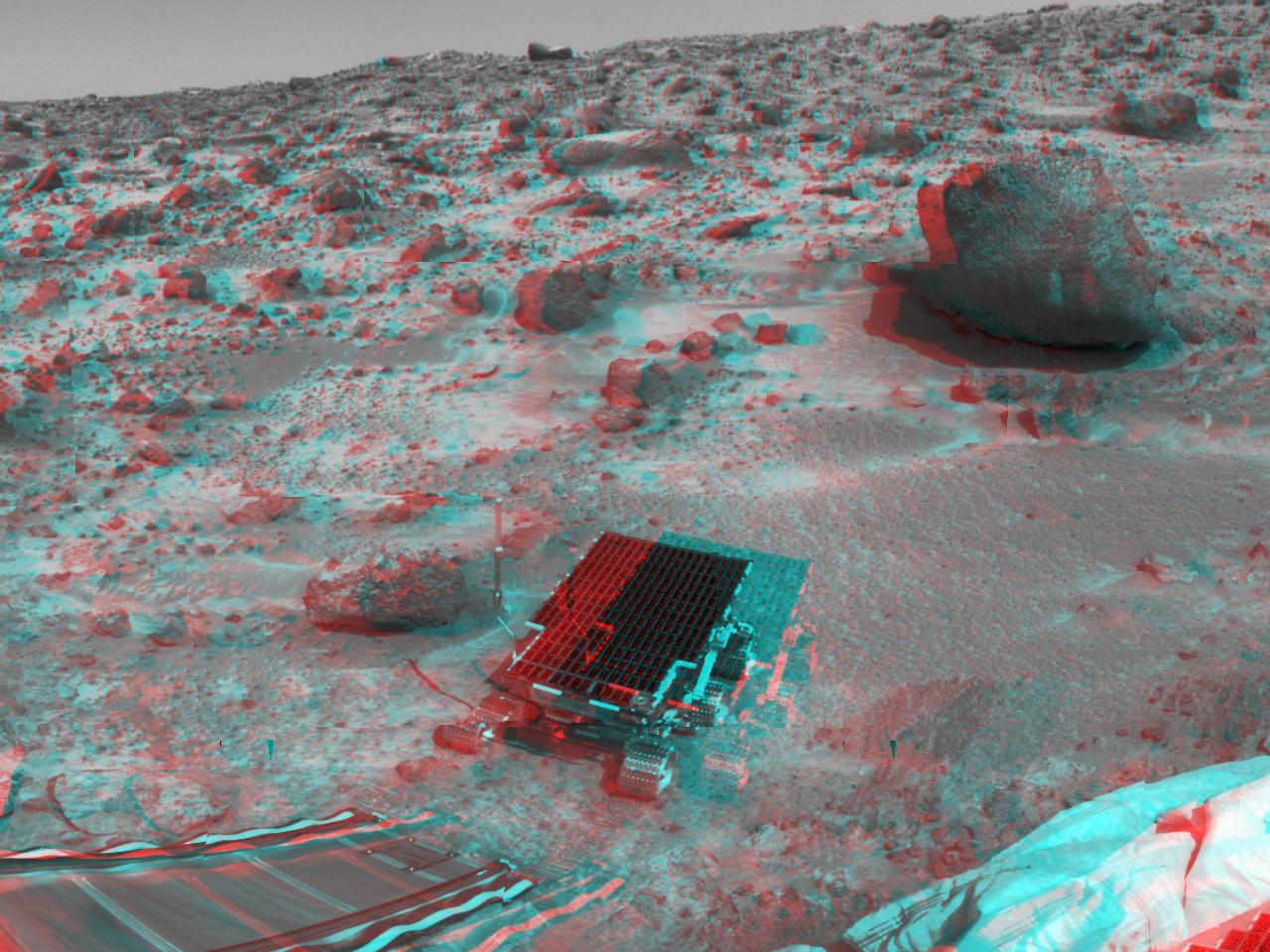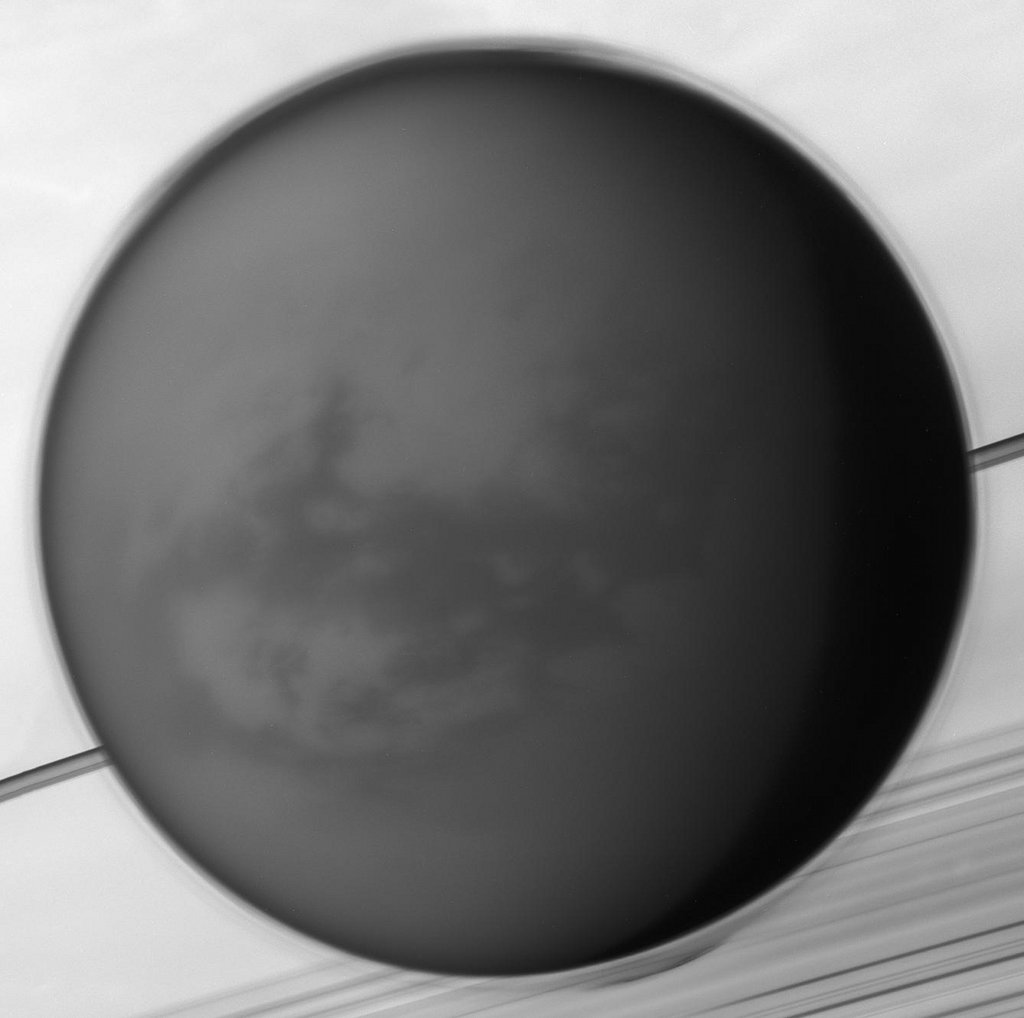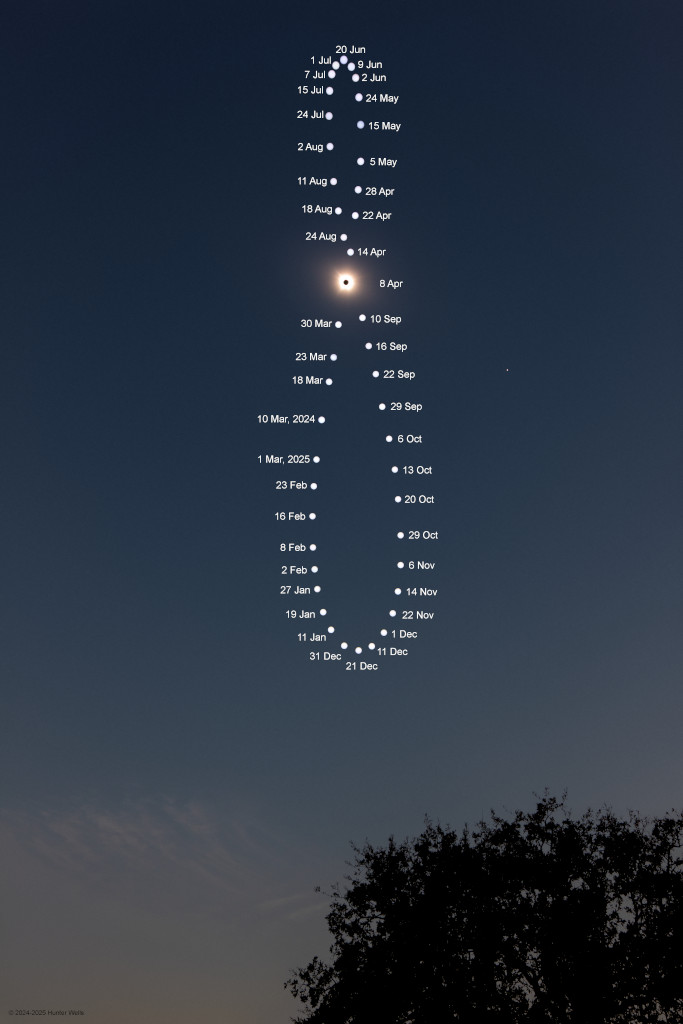Bildcredit und Bildrechte: Robert Eder
Die große, schöne Balkenspiralgalaxie Messier 109 ist der 109. Eintrag im berühmten Katalog heller Nebel und Sternhaufen von Charles Messier. Sie befindet sich direkt unterhalb der Schale des Großen Wagens im nördlichen Sternbild Großer Bär (Ursa Major).
Der helle Stern Phecda (Gamma Ursae Majoris) verursacht das helle Leuchten in der oberen rechten Ecke dieses teleskopischen Bildausschnitts. Der markante zentrale Balken von M109 verleiht der Galaxie das Aussehen des griechischen Buchstabens „Theta“ (θ), einem in der Mathematik häufig verwendeten Symbol für einen Winkel.
Obwohl M109 am Himmel der Erde nur einen sehr kleinen Winkel einnimmt (etwa 7 Bogenminuten oder 0,12 Grad), entspricht dieser geringe Winkel in Wirklichkeit einem enormen Durchmesser von etwa 120.000 Lichtjahren bei einer geschätzten Entfernung von 60 Millionen Lichtjahren.
M109 (auch bekannt als NGC 3992) ist das hellste Mitglied des mittlerweile anerkannten Galaxienhaufens im Großen Bären (Ursa Major-Galaxienhaufen). In der Aufnahme sind auch einige helle Vordergrundsterne mit spitzen Strahlen zu sehen. Außerdem erscheinen drei kleine, verschwommene, bläuliche Galaxien, die von oben nach unten als UGC 6969, UGC 6940 und UGC 6923 bezeichnet wurden. Sie sind möglicherweise Satellitengalaxien der größeren Balkenspiralgalaxie Messier 109.