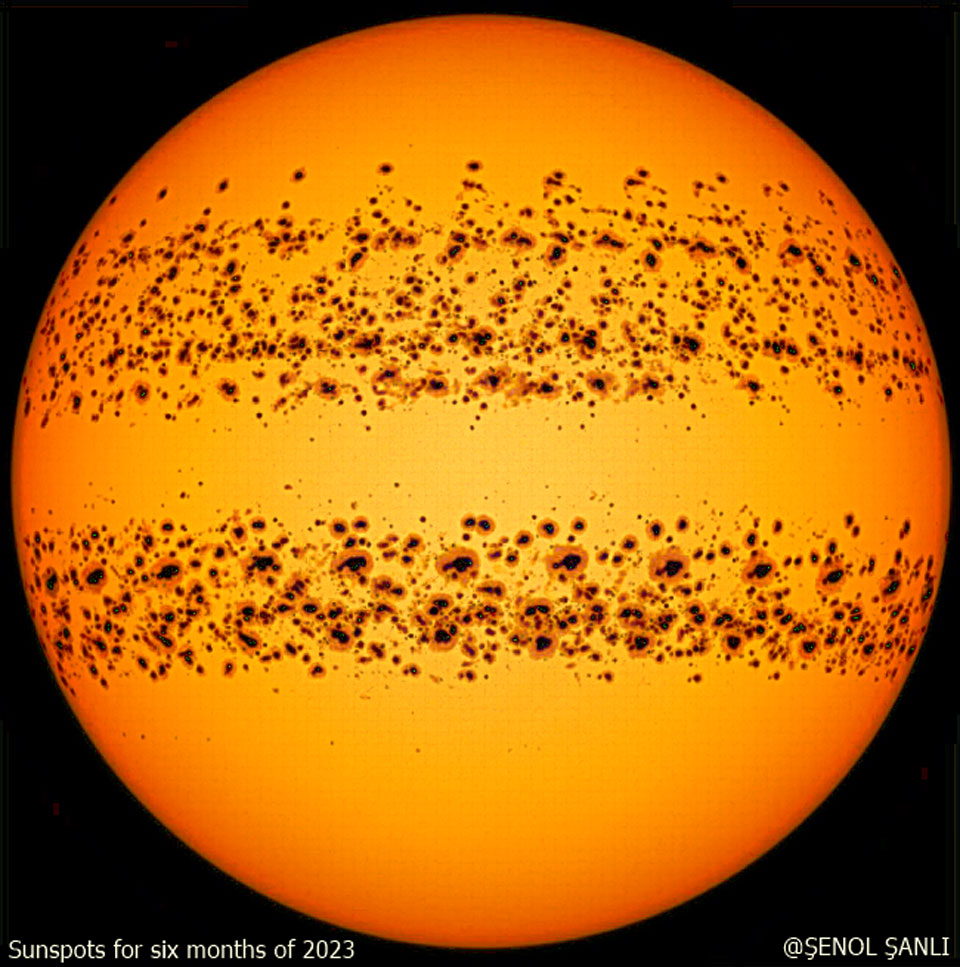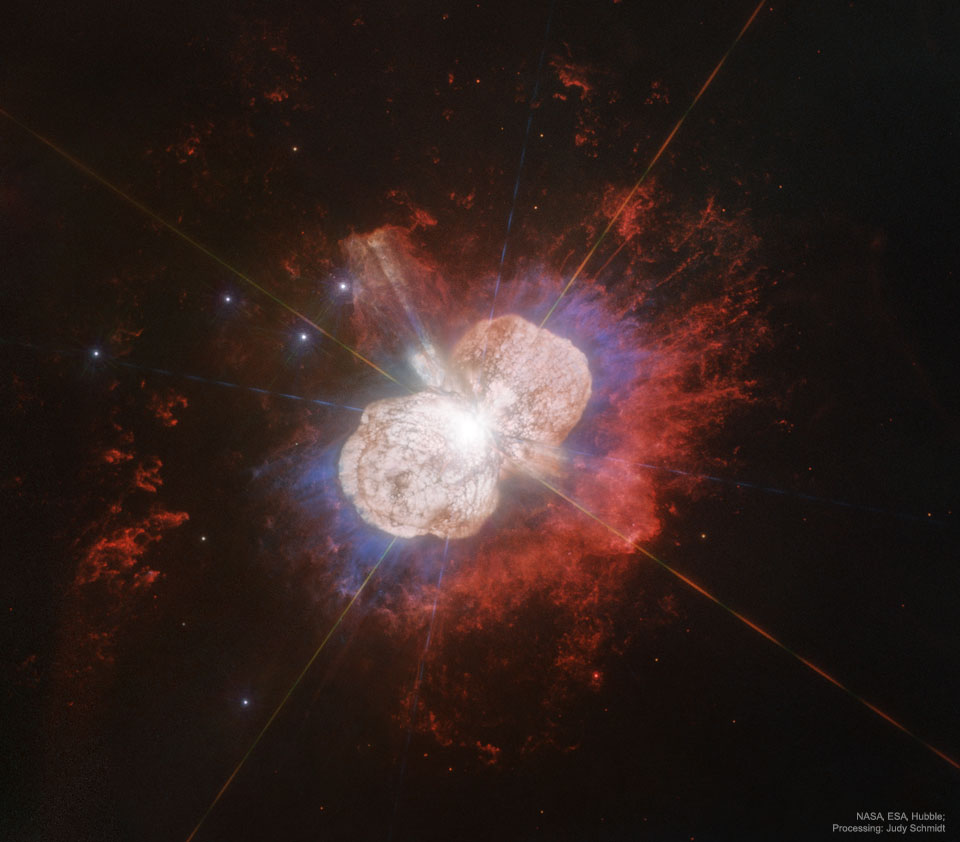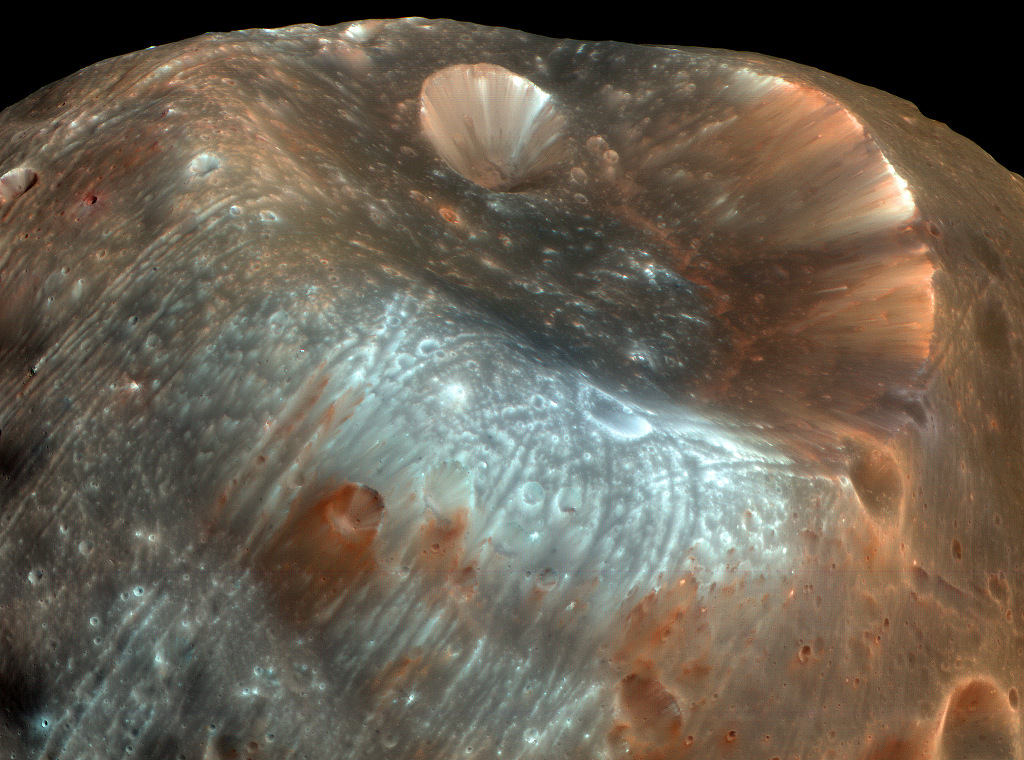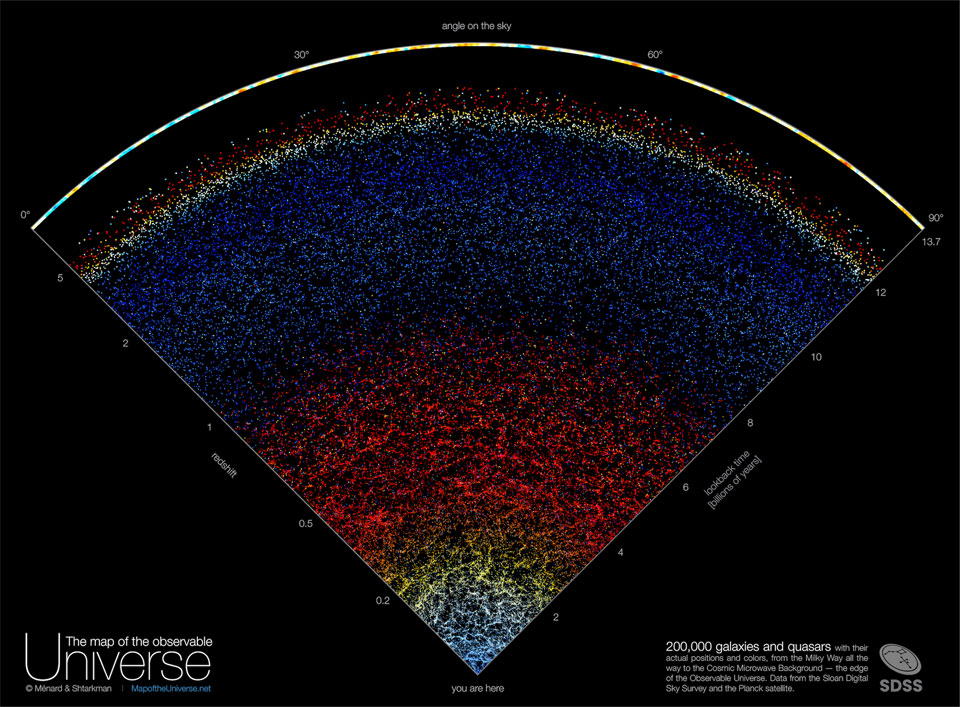Bildcredit: Mark Hanson; Daten: Mike Selby
Warum haben manche Spiralgalaxien einen Ring um ihr Zentrum? Die Spiralgalaxie NGC 1398 hat nicht nur einen Ring aus Sternen, Gas und Staub, die perlenartig um das Zentrum angeordnet sind, sondern auch einen Balken aus Sternen und Gas, der über ihr Zentrum verläuft, sowie Spiralarme, die weiter außen wie Bänder erscheinen.
Dieses detailreiche Bild zeigt eindrucksvolle Details der prächtigen Spiralgalaxie. NGC 1398 ist etwa 65 Millionen Lichtjahre entfernt. Das bedeutet, dass das Licht, das wir heute sehen, von der Galaxie ausströmte, als die Dinosaurier von der Erde verschwanden.
Die fotogene Galaxie ist mit einem kleinen Teleskop im Sternbild Chemischer Ofen (Fornax) zu sehen. Der Ring nahe dem Zentrum ist wahrscheinlich eine expandierende Sternbildungs-Dichtewelle, die entweder bei einer gravitativen Begegnung mit einer weiteren Galaxie oder durch die gravitative Asymmetrie der Galaxie entstand.