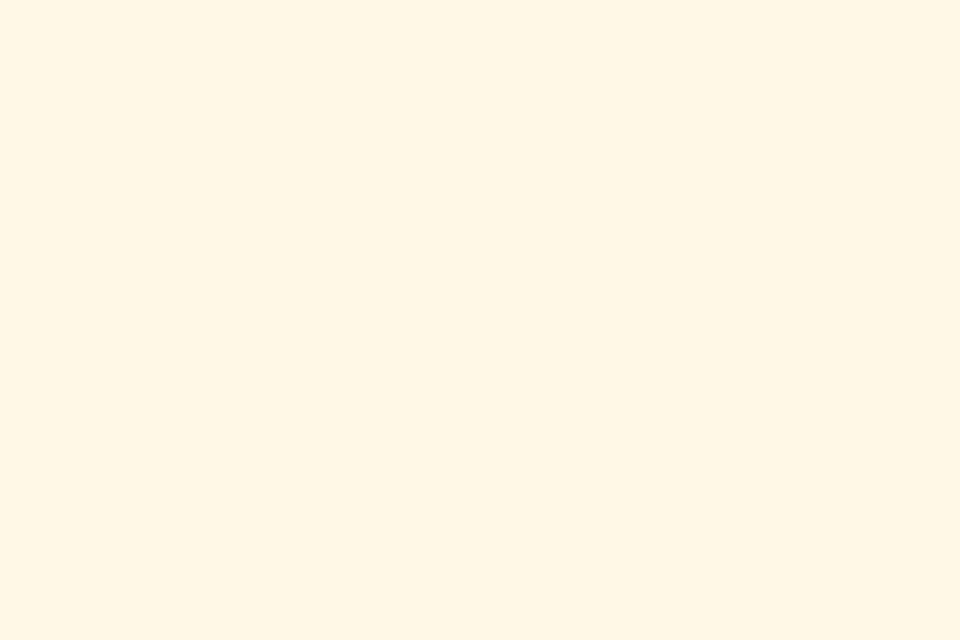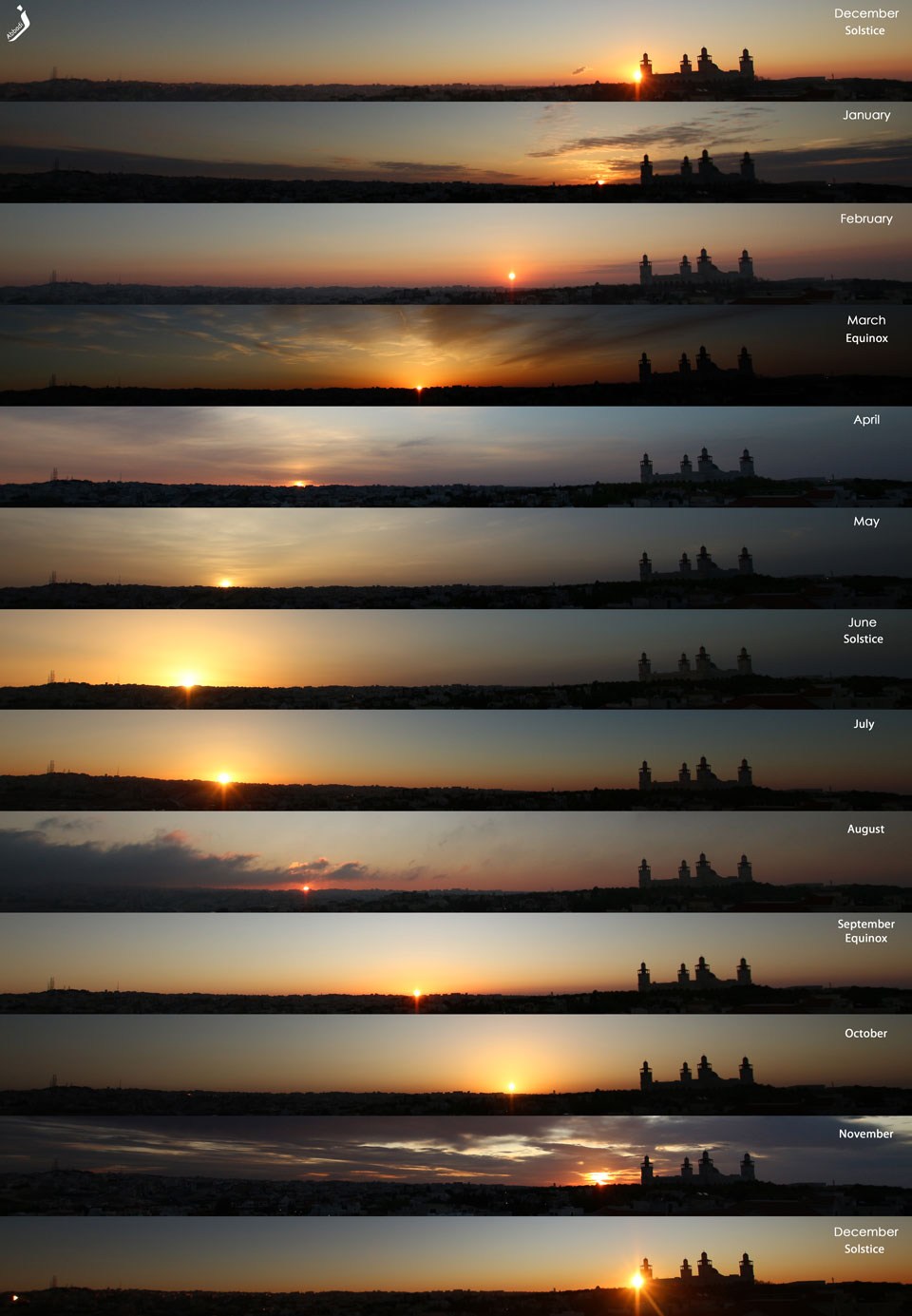Bildcredit und Bildrechte: Nicolas Paladini
Beschreibung: Aus der Ferne sieht das Ganze wie ein Adler aus. Bei näherer Betrachtung des Adlernebels erkennt man jedoch, dass die helle Region eigentlich ein Fenster ins Zentrum der größeren dunklen Staubhülle ist. Durch dieses Fenster gelangt man in eine hell erleuchtete Werkstatt, in der gerade ein ganzer offener Sternhaufen entsteht.
Im Inneren der Höhle bleiben hohe Säulen und runde Globulen aus dunklem Staub und kaltem molekularem Gas übrig, in denen immer noch Sterne entstehen. Schon sind mehrere junge helle blaue Sterne zu sehen, die mit ihrem Licht und ihren Sternenwinden die übrig gebliebenen Fasern und Wände aus Gas und Staub regelrecht verheizen und zurückdrängen.
Der Adler-Emissionsnebel wird als M16 bezeichnet, er ist ungefähr 6500 Lichtjahre entfernt, zirka 20 Lichtjahre groß und mit Fernglas im Sternbild Schlange (Serpens) zu sehen. Das Bild umfasst eine Belichtungszeit von mehr als 12 Stunden und kombiniert drei spezifische Farben, die von Schwefel (rot gefärbt), Wasserstoff (gelb) und Sauerstoff (blau) abgestrahlt werden.
Galerie: Interessante Bilder der totalen Sonnenfinsternis, die an APOD geschickt wurden
Zur Originalseite