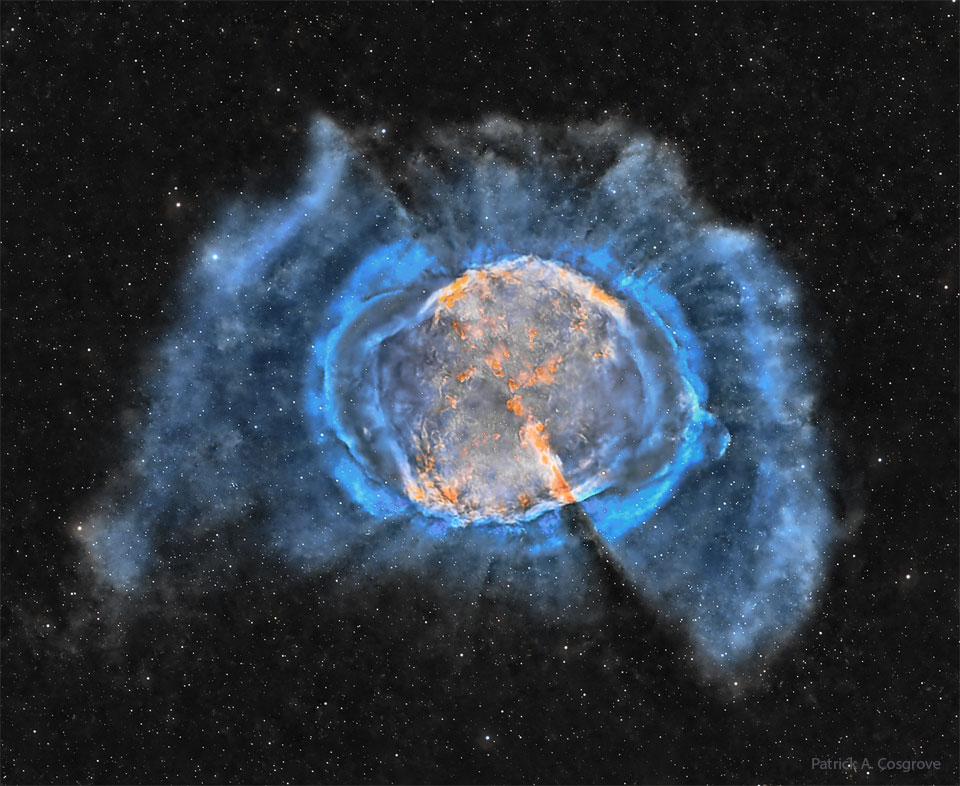Videocredit: TNG-Arbeitsgemeinschaft, MPCDF, FAS Harvard U.; Musik: World’s Sunrise (YouTube: Jimena Contreras)
Wie sind wir hierher gekommen? Wir wissen, dass wir auf einem Planeten leben, der um einen Stern kreist, der wiederum die Galaxis umrundet, doch wie ist das alles entstanden? Unser Universum bewegt sich zu langsam, um das zu beobachten. Daher wurden schnelle Computersimulationen erstellt, um das herauszufinden. Dieses Video der Arbeitsgemeinschaft IllustrisTNG simuliert die Bewegung von Gas ab dem frühen Universum (Rotverschiebung 12) bis heute (Rotverschiebung 0).
Zu Beginn der Simulation fällt Gas aus der Umgebung in eine Region mit relativ hoher Gravitation und sammelt sich dort an. Nach wenigen Milliarden Jahren bildet sich bei dem faszinierenden kosmischen Tanz ein klar definiertes Zentrum. Gasklumpen fallen weiterhin in die rotierende Galaxie. Manche davon sind kleine Begleitgalaxien. Sie werden aufgenommen, bis am Ende des Videos die gegenwärtige Epoche erreicht ist.
Doch für die Milchstraße sind die großen Verschmelzungen vielleicht noch nicht vorbei. Es gibt aktuelle Hinweise, dass unsere große Spiralgalaxie in einigen Milliarden Jahren mit der etwas größeren Andromeda-Spiralgalaxie kollidiert und verschmilzt.
Offene Wissenschaft: Stöbert in mehr als 3000 Codes der Quellcodebibliothek für Astrophysik