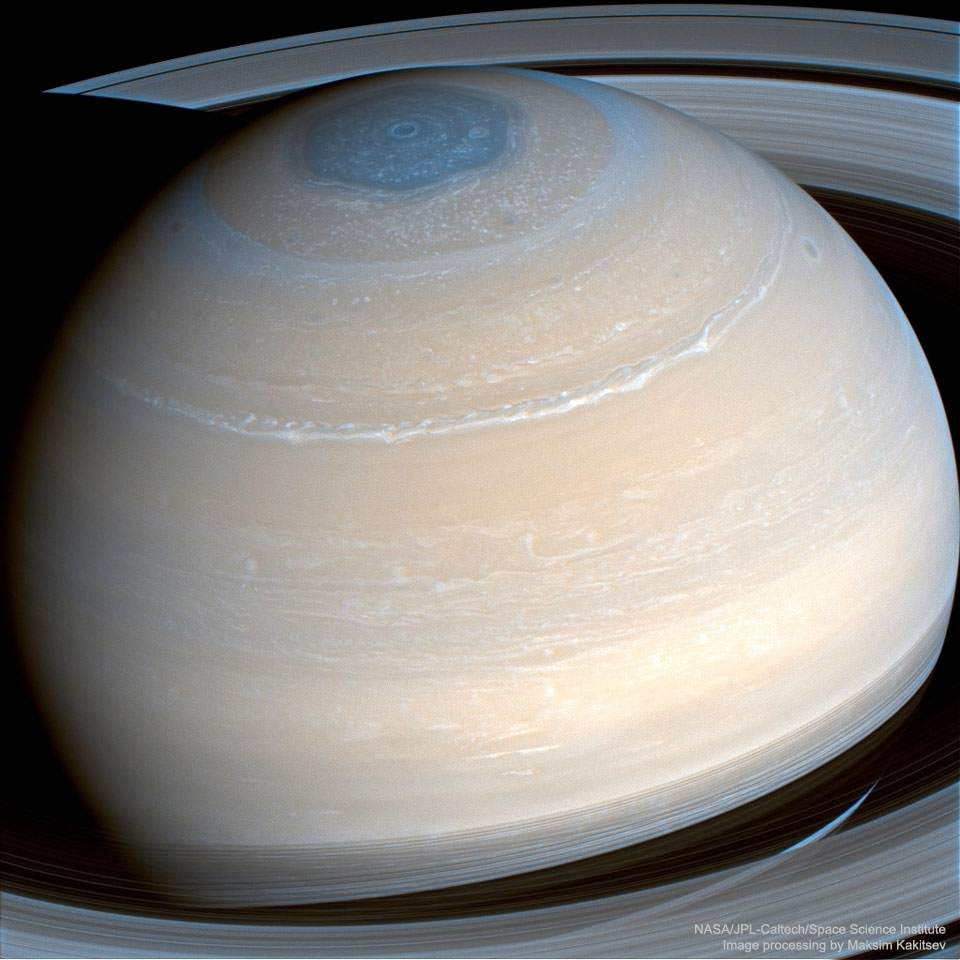Bildcredit und Bildrechte: Leonardo Julio (Astronomia Pampeana)
Die Silhouette des Dunkelnebels LDN 1622 liegt in der kosmischen Szene. Lynds Dunkelnebel (LDN) 1622 liegt unten in der Mitte vor einem blassen Hintergrund aus leuchtendem Wasserstoff. Man erkennt ihn nur auf lang belichteten Aufnahmen der Region, die mit Teleskop fotografiert werden.
LDN 1622 liegt nahe der Ebene unserer Milchstraße. Am Himmel befindet er sich in der Nähe der Barnardschleife. Das ist eine große Wolke um den ergiebigen Komplex aus Emissionsnebeln in Gürtel und Schwert des Orion. Oben verlaufen Bögen eines Segments der Barnardschleife. Der undurchsichtige Staub von LDN 1622 ist vermutlich viel näher als Orions berühmtere Nebel, er ist vielleicht nur 500 Lichtjahre entfernt. In dieser Distanz wäre dieses 1 Grad große Sichtfeld weniger als 10 Lichtjahre breit.