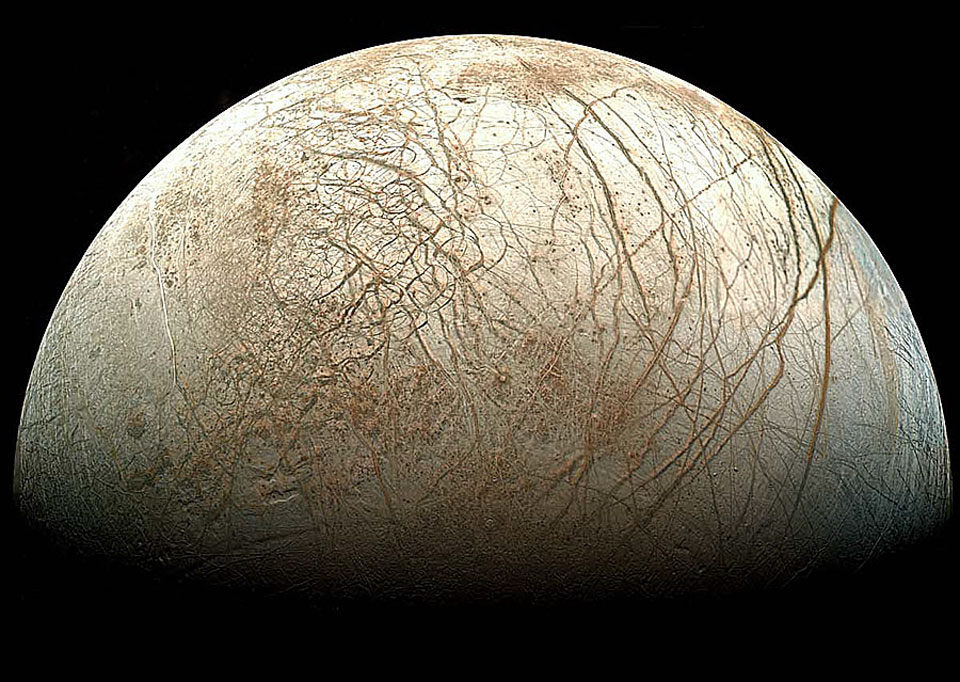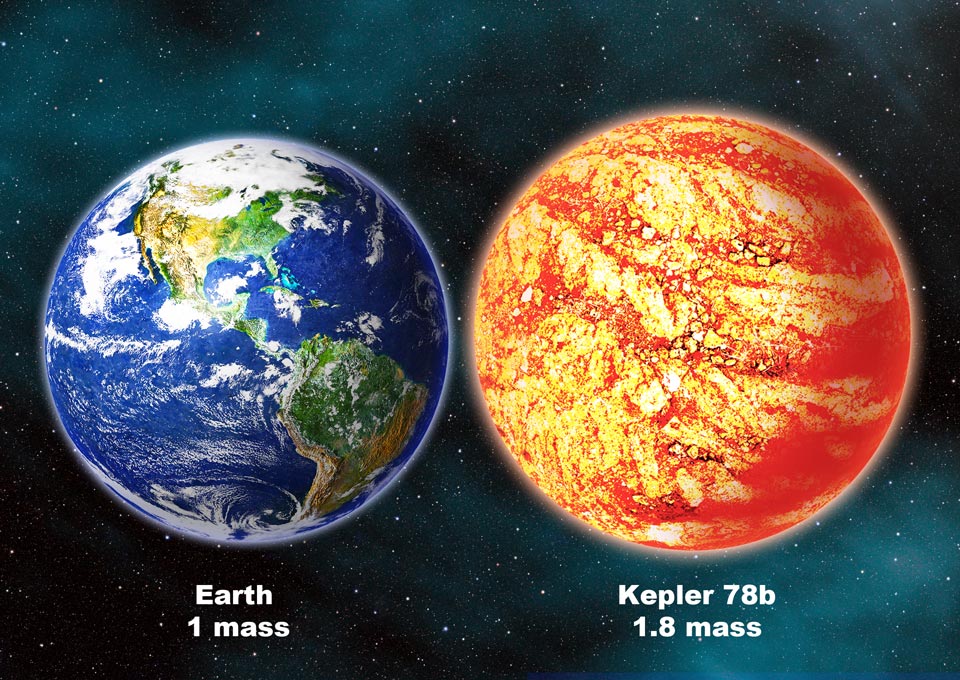Bildcredit und Bildrechte: Babak Tafreshi (TWAN)
Die Sterne blinkten auf, als die Abenddämmerung verblasste. Diese stille Himmelslandschaft erinnert an ein persisches Sprichwort: „Die Nacht verbirgt die Welt, doch sie enthüllt ein Universum.“ Die Szene wurde letzten November in Kenia fotografiert.
Im Norden ging die Sonne unter. Bald verbarg die Nacht das Ufer des Turkanasees. Dort gibt es viele Nilkrokodile. Die Region ist bekannt für ihren Reichtum an menschlichen Fossilien. Sie gilt als Wiege der Menschheit.
Die gleißende Venus war damals der Abendstern der Welt. Sie bestimmte die sternklare Nacht. Im zierlichen Bogen unserer Milchstraße waren auch zarte Sterne, kosmische Staubwolken und leuchtende Nebel zu sehen.