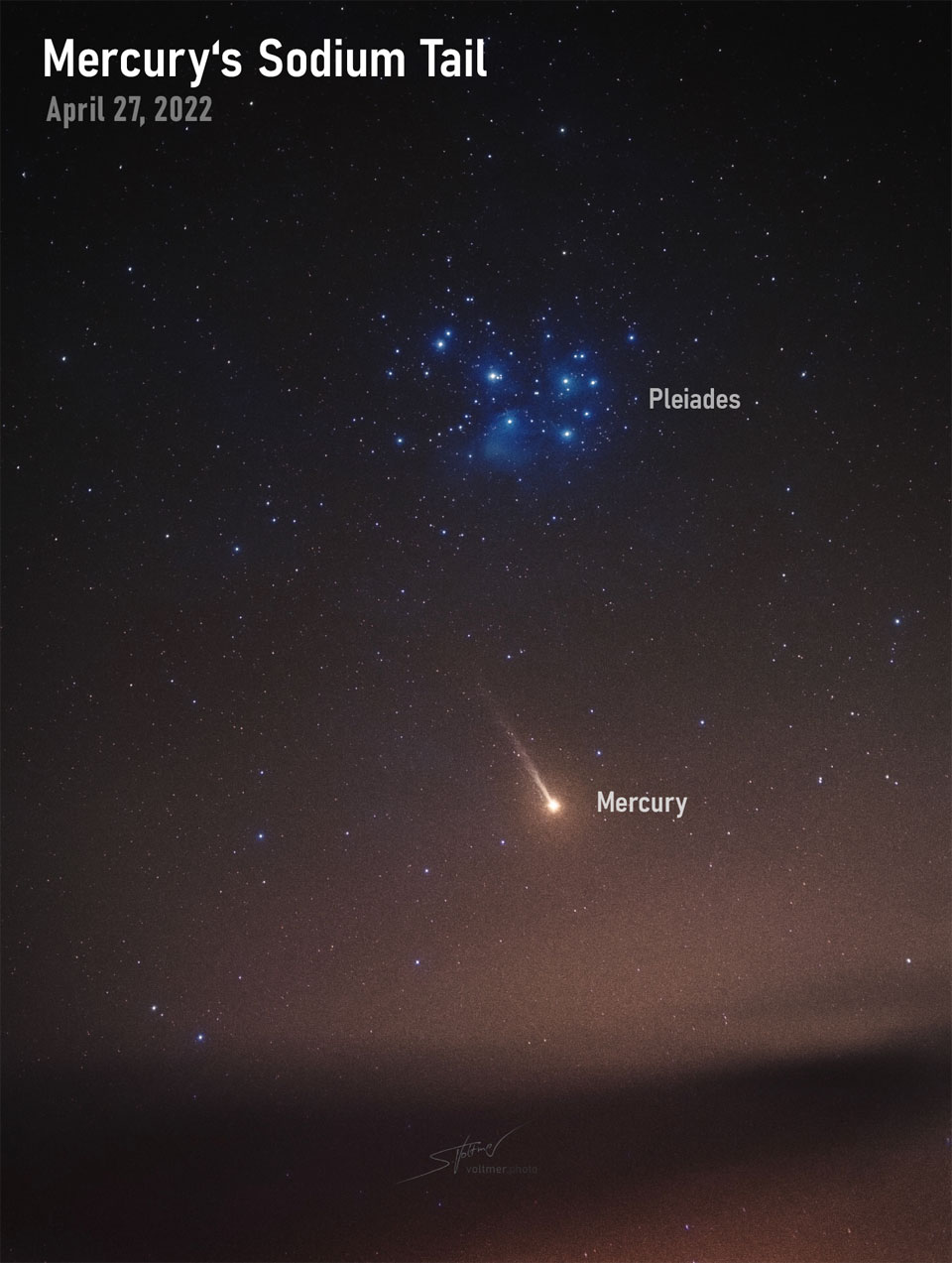Bildcredit: NASA, ESA, Antonella Nota (ESA/STScI) et al.,
Die massereichen Sterne von NGC 346 sind kurzlebig, aber sehr energiegeladen. Der Sternhaufen ist in die größte Sternbildungsregion in der Kleinen Magellanschen Wolke eingebettet, diese ist etwa 210.000 Lichtjahre entfernt.
Die stellaren Winde und die Strahlung der Sterne sprengen eine interstellare Höhlung in die großen Gas- und Staubwolken mit einem Durchmesser von etwa 200 Lichtjahren. Dabei lösen sie Sternbildung aus und prägen den dichten inneren Rand der Region.
Die Sternbildungsregion ist als N66 katalogisiert und enthält anscheinend auch eine große Population junger Sterne. Die jungen, etwa 3 bis 5 Millionen Jahre alten Sterne, die im eingebetteten Sternhaufen verstreut sind, verbrennen in ihren Kernen noch keinen Wasserstoff.
Auf diesem Falschfarbenbild des Weltraumteleskops Hubble sind sichtbares und nahinfrarotes Licht in Blau und Grün abgebildet. Das Licht der Emissionen von atomarem Wasserstoff ist rot.